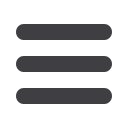

Gutachtliche Entscheidungen
163
Anträge zur Überprüfung der Thromboseprophylaxe be-
schäftigen die Gutachterkommission immer wieder, so auch
im folgenden Fall: Eine 26-jährige schlanke Patientin (170
cm, 56 kg) wurde am 4. September wegen des Rezidivs einer
gutartigen Milzzyste laparoskopisch operiert. Nach sachge-
rechter chirurgischer und anästhesiologischer Aufklärung
am Vortag dauerte die laparoskopische Operation etwa vier
Stunden. Der Eingriff war erschwert durch Adhäsionen und
Einlage einer Netzplombe im Rahmen der ersten Operation
vor sechs Jahren.Während der jetzigen Operation kam es zu
einem kleinen Einriss am unteren Milzpol und zu einer klei-
nen Zwerchfellverletzung; eine Bülau-Drainage für vier
Tage war erforderlich.Nach dem Einsatz von Klammernaht-
gerät, Argonbeamer und Fibrinkleber sowie Fibrinvlies war
der postoperative Verlauf komplikationsfrei. Die Bülau-
Drainage wurde am 7. September entfernt, die Thrombose-
prophylaxe mit einer abendlichen Dosis von Clexane 20 mg
wurde ab dem 3. September abends bis zur Entlassung am
9. September einschließlich des Operationstags durchge-
führt.
Wegen Fieber und Oberbauchbeschwerden wurde die Pa-
tientin vom 18. bis 24. September erneut stationär behandelt.
Als Fieberursache stellte sich ein Sekretverhalt im Operati-
onsgebiet heraus, der CT-gesteuert punktiert und drainiert
wurde. Die Drainage blieb über die Entlassung hinaus bis
zum 4. Oktober belassen. Auch während des zweiten statio-
nären Aufenthalts erhielt die Patientin täglich eine Throm-
boseprophylaxe mit 20 mg niedermolekularem Heparin
(NMH).
Am 27. September gab die Patientin erstmals Schmerzen im
linken Bein an. Klinisch und duplexsonographisch war am
8. Oktober eine Thrombose nicht nachzuweisen; auch eine
weitere Ultraschallkontrolle am 15. Oktober ließ keine
Thrombosezeichen erkennen.
Wegen „schlimmer Schmerzen im ganzen Bein“ und Kreis-
laufproblemen wurde die Patientin am 20.Oktober in einem
anderen Krankenhaus wieder aufgenommen.Dort wurde ei-
ne Becken-Bein-Venen-Thrombose diagnostiziert und am
22.Oktober eine Marcumar-Therapie begonnen.
Beurteilung des Falles
Die Indikation zur Operation, die Operation selbst, die post-
operative Therapie und die präoperative Aufklärung zum
Eingriff sind nicht zu beanstanden. Die Gestaltung der ve-
nösen Thromboseprophylaxe perioperativ, bei Immobilisa-
tion, aber auch bei zahlreichen internistischen Erkrankun-
gen und bei längerer Bettlägerigkeit ist bis heute ein wissen-
schaftlich und klinisch noch nicht abgeschlossenes Thema.
Der Gefahr einer Thrombose mit akuter Bildung von Blutge-
rinnseln im venösen Bereich, vor allen Dingen intra- und
postoperativ in den Becken- und Beinvenen mit der Gefahr
einer Lungenembolie, stehen die Gefahren einer intra- und
postoperativen Blutung, einer Blutung im Bereich des Magen-
Darm-Trakts oder auch einer heparininduzierten Thrombo-
zytopenie (HIT I + II) als andere Risiken gegenüber. Bei je-
dem zehnten Patienten mit großen chirurgischen Eingriffen
und Heparinprophylaxe muss mit einer HIT II-Entwicklung
gerechnet werden, selbst bei Verwendung von niedermole-
kularemHeparin noch bei zwei bis drei Prozent.Diese kann
ihrerseits schwere Blutungen auslösen und ist im Fall von
HIT II, wenn die Diagnose nicht sehr rasch gestellt und ent-
sprechend gehandelt wird, ebenfalls lebensgefährlich.
Zur Einschätzung des individuellen Thromboserisikos wer-
den Risikoklassen von 1 bis 3 gebildet, die auf Statistiken
beruhen [1, 2, 3].Wird ein Patient als niedriges Risiko (Klas-
se 1) klassifiziert, kann bei rascher Vollmobilisation nach
überwiegender Meinung auf eine medikamentöse Prophy-
laxe verzichtet werden. Gehört er der Klasse 2 an (mittleres
Risiko), wie auch im vorliegenden Fall, wird er nach derzeit
geltenden Empfehlungen über eine begrenzte Zeit mit mitt-
leren Antikoagulantiendosen behandelt. Für Patienten der
Gruppe 3 wird zu einer länger dauernden, hoch dosierten
antithrombotischen Therapie unter Inkaufnahme eines hö-
heren Therapierisikos geraten. Hinzuweisen ist darauf, dass
die Diskussion zu diesemThema noch in Gang war,weshalb
auch die deutschen Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft
wissenschaftlicher Fachgesellschaften (AWMF) seit 2003 bis
2007 noch keine Neubearbeitung erfahren hatten. Die Pa-
tientin war in diesem Fall nach demThromboseprophylaxe-
Schema Mainz [4] in Risikogruppe 2 (1–2,5 Punkte) einzu-
ordnen, da sie unter Contraceptiva (0,5 Punkte) stand und
die Operation über 1 Stunde ohne Immobilisation über 3 Ta-
ge (1 Punkt) dauerte.
Bislang gibt es für das Absetzen einer oralen Kontrazeption,
das mindestens vier bis sechs Wochen vor der Operation ge-
schehen müsste, keine positive Empfehlung. Entsprechende
Studien standen bis einschließlich 2007 nicht zur Verfü-
gung. Allerdings sollte bereits bei der stationären Aufnahme
eine mögliche hormonelle Kontrazeption anamnestisch er-
fasst werden, was im Einwilligungsformular auch gesche-
hen war. Auch thromboembolische Ereignisse beim Patien-
ten oder in der Familie sollten ausgeschlossen werden. Lie-
gen solche Ereignisse vor,müssen diese in die Überlegungen
hinsichtlich einer adäquaten medikamentösen Thrombose-
prophylaxe miteinbezogen werden; sie führen in der Regel
zu einer Dosiserhöhung.
Insofern ist das Für und Wider einer medikamentösen
Thromboseprophylaxe an sich und hinsichtlich der Dosie-
rung speziell sorgfältig abzuwägen. Dies ist in diesem Fall
geschehen.
Die Thromboseprophylaxe mit niedermolekularemHeparin
wurde zeitgerecht begonnen und fortgeführt. Für die Risiko-
klasse 2 war die Verabreichung des Heparins während der
stationären Zeit ausreichend; die Patientin war zum Zeit-
punkt der Entlassung am 9. September und am 24. Septem-
ber komplett mobilisiert. Zudem handelte es sich um einen
laparoskopischen Oberbauch- und nicht Unterbaucheingriff
bei einer gutartigen Erkrankung.
Thromboseprophylaxe bei laparoskopischem Eingriff
und Einnahme von Contraceptiva



















