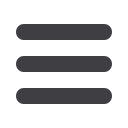

7
Vorwort der Schweizer Ausgabe
Das Gespräch zwischen Arzt und Patient ist das Fundament einer guten Behandlung. Patienten
wollen gehört werden, wenn es darum geht, ihre Beschwerden diagnostisch einzuordnen und
allenfalls zu behandeln. Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber sie ist noch immer aktuell. In den
frühen 70er-Jahren untersuchten Experten erstmals die Gespräche zwischen Ärzten und Pa-
tienten und entdeckten dabei, dass diese häufig Defizite aufwiesen. Die Ärzte unterbrachen den
Redefluss des Patienten meist nach weniger als einer halben Minute und verpassten dadurch
manchmal wichtige Informationen über den Zustand des Patienten. Manche Patienten wiede-
rum verstanden nicht, was Ärzte ihnen mitteilten. Wenn sie die Arztpraxis verließen, wussten sie
nicht genau, was der Arzt ihnen eben erklärt hatte und was sie nun tun sollten.
Dass die ungenügende Kommunikation problematisch sein kann, ist in der wissenschaftlichen
Literatur mittlerweile recht gut belegt. Dazu gehören zum Beispiel eine erhöhte Wahrscheinlich-
keit einer Fehldiagnose, ein gestörtes Vertrauensverhältnis, das Anfordern unnötiger Tests und
eine mangelhafte Compliance. Am Ende kann es zum Bruch zwischen Arzt und Patient kommen
und zu einem Arztwechsel. In den USA werden viele Klagen gegen Ärzte unter anderem auch
damit begründet, dass der Arzt nicht zugehört habe und dass er den Patienten nicht respektvoll
behandelt habe. Und: Die häufigsten Defizite, die Patienten während eines Krankenhausaufent-
haltes beklagen, liegen im Bereich Kommunikation und Aufklärung.
Wenn hingegen eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Arzt und Patient besteht, dann kann
das dazu führen, dass beim Patienten weniger Komplikationen auftreten. Der Arzt kann Fort-
schritte beim Patienten besser erkennen oder den richtigen Zeitpunkt, um ein Medikament ab-
zusetzen. Das gilt insbesondere für chronisch kranke Patienten, von denen es in Zukunft immer
mehr geben wird. Die Patientenzufriedenheit und -treue steigen.
Die Beziehung zwischen Arzt und Patient hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert.
Früher war der paternalistische Ansatz verbreitet, bei dem der Arzt zum Wohle des Patienten
entscheidet: Der Arzt weiß, was im besten Interesse des Patienten ist, und dementsprechend
entscheidet er darüber, welche Informationen er mitteilt und welche Behandlung er empfiehlt.
Der Patient hat dabei kaum eine Möglichkeit, seine eigene Position einzubringen.
Mittlerweile ist diese Asymmetrie kleiner geworden, das Gewicht hat sich in den letzten Jahren
in Richtung Patient verschoben. Noch immer ist das Verhältnis zwischen Arzt und Patient zwar
in den meisten Fällen asymmetrisch, denn der Patient kommt zum Arzt, um gesund zu werden,
und viele Patienten sind froh, wenn der Arzt ihnen sagt, was zu tun ist. Aber immer mehr wird
Ärztekammer
Nordrhein



















