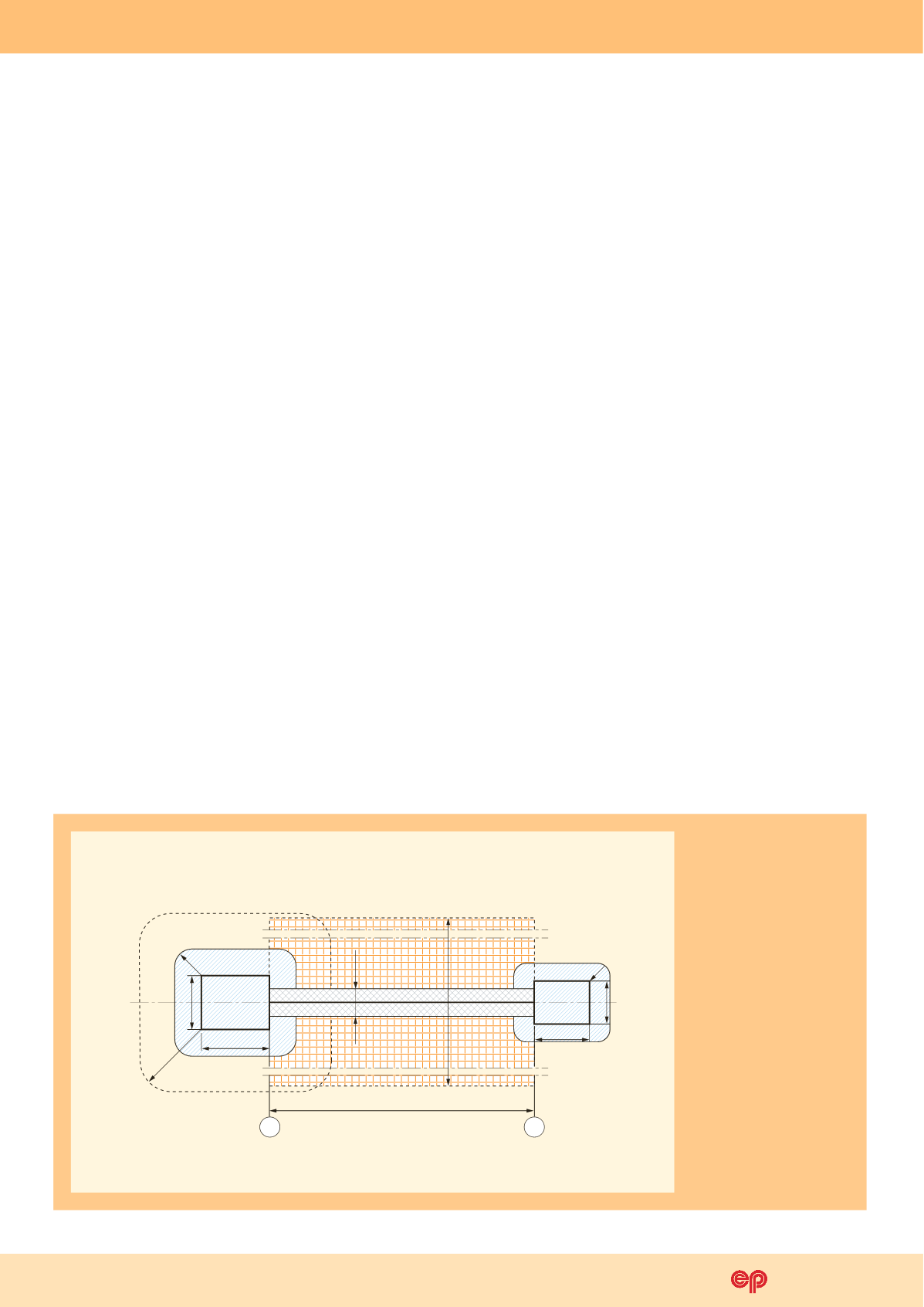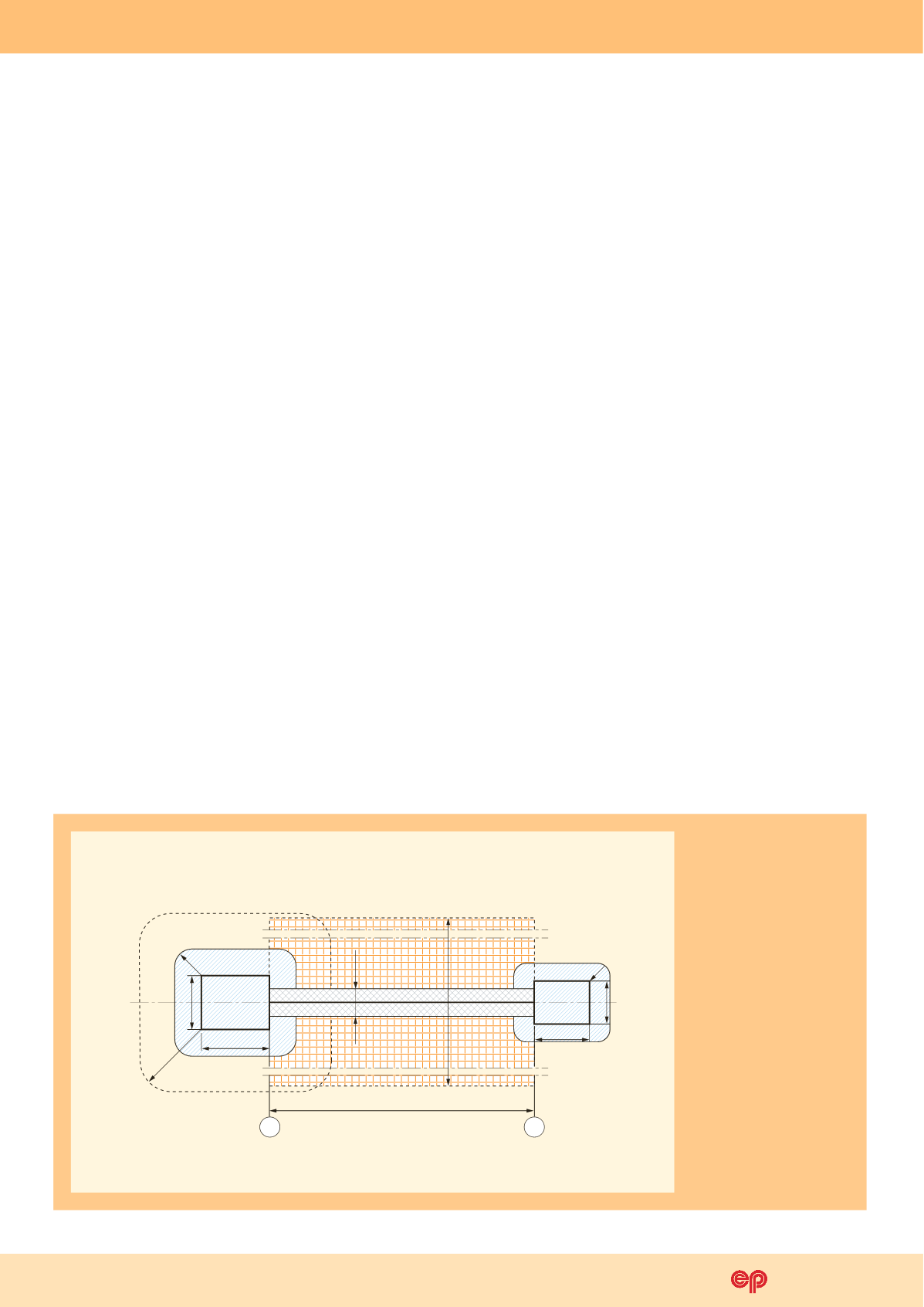
6
– Sonderheft
NORMEN UND VORSCHRIFTEN
3.2 Weitere Änderungen
]
Die Festlegungen zu Einfangflächen
für direkte Blitzeinschläge in bauliche
Anlagen
A
d
, für nahe Blitzeinschläge
A
m
, sowie für direkte und indirekte
Blitzeinschläge in eingeführte Versor-
gungsleitungen,
A
l
und
A
i
, wurden
überarbeitet und neue Erkenntnisse
eingearbeitet (Bild
).
]
Es wird detaillierter unterschieden
zwischen Überspannungs-Schutzge-
räten zum Zwecke des Blitzschutz-
Potentialausgleichs (Parameter
P
EB
)
und dem Einsatz von koordinierten
Systemen von Überspannungs-Schutz-
geräten (Parameter
P
SPD
). Damit ist
auch eine bessere Berücksichtigung
der unterschiedlichen Schutzwirkungen
dieser Maßnahmen bei direkten und
indirekten Blitzeinwirkungen möglich.
]
Der Anhang C beschreibt die Abschät-
zung der jeweiligen Verluste für die
einzelnen Schadensarten. Bei den Ver-
lustfaktoren
L
x
entfällt weitgehend die
Festlegung der grundlegenden Berech-
nungsformeln; es werden also im
Wesentlichen nur noch „typische
Werte“ in Tabellenform aufgeführt.
]
Im Falle der Risikoanalyse für explo-
sionsgefährdete Anlagen ist nun auch
die Berücksichtigung von Zonen 1 und
2 bzw. 21 und 22 möglich, nicht nur
von Zonen 0 bzw. 20. Dies geschieht
über eine abgestufte Festlegung des
Parameters für das Brand- bzw. Explo-
sionsrisiko einer baulichen Anlage
r
f
.
Zur besseren Anwendbarkeit des
Normenteils 2 und für zusätzliche Infor-
mationen gibt es in Deutschland drei
Beiblätter:
]
Beiblatt 1
– Blitzgefährdung in
Deutschland: Zur Verfügung gestellt
wird eine aktualisierte Karte der
Blitzdichte für die KFZ-Kennzeichen-
gebiete (Mittelwert der Jahre 1999 –
2011).
]
Beiblatt 2
– Berechnungshilfe zur
Abschätzung des Schadensrisikos für
bauliche Anlagen: Die Berechnungs-
hilfe wird wieder auf Basis einer EXCEL-
Liste mit Druckfunktion zur Verfügung
gestellt – jedoch deutlich detaillierter
gefasst. Mit ihr können nun alle Inhalte
und Verfahren der Risikoanalyse voll-
ständig beschrieben werden.
]
Beiblatt 3
– Zusätzliche Informatio-
nen zur Anwendung der DIN EN
62305-2: Dieses neue Beiblatt soll
insbesondere Informationen umfassen,
wie und unter welchen Voraus-
setzungen Überspannungs-Schutz-
geräte mit erhöhter Wirksamkeit (also
geringeren Schadenswahrscheinlich-
keiten
P
EB
und
P
SPD
als für den Gefähr-
dungspegel
I
beschrieben) berück-
sichtigt werden können, und wie das
Risikomanagement für Anlagen mit
Explosionsgefährdung angewendet
werden kann.
4 IEC/DIN EN 62305-3
Bauliche Anlagen,
Personen
Die bedeutendste Änderung betrifft die
Berechnung des sog. Trennungsabstands,
der nun nach zwei im normativen Teil
beschriebenen Verfahren durchgeführt
werden kann.
]
Das überschlägige Verfahren kann bei
einfachen, typischen Gebäuden an-
gewendet werden, wobei der Blitz-
einschlag in die Dachecken bzw.
-kanten erfolgt. Dieser Einschlag stellt
bei vielen Gebäuden auch den un-
günstigsten Fall (worst case) dar,
zumindest solange Länge und Breite
des Gebäudes nicht größer sind als die
vierfache Gebäudehöhe.
]
Das exakte Verfahren kann besser in
anderen Fällen (z. B. bei komplexer
Gebäudegeometrie) und für detaillierte
Berechnungen verwendet werden.
Hier ergibt sich der erforderliche
Trennungsabstand durch Addieren der
einzelnen Anteile, die entlang der vom
Blitzstrom durchflossenen
n
Teillängen
(Fangleitungen und Ableitungen) ent-
stehen (s. folgenden Beitrag in diesem
Heft).
Als weitere Änderungen sind zu nennen:
]
Für Ringleitungen werden nicht mehr
die gleichen Abstände gefordert wie
für Ableitungen. Die typischen Ab-
stände nach Tabelle 4 gelten nur noch
für Ableitungen.
4 000 m
4 0 m
b
a
3
c
>
a
/
a
/
b
3
a
(
d/a
(
d/b
(
i
(
l
(
m
3
/
b
>
b
3
b
500 m
Berechnungen
der Einfangflächen nach
IEC 62305-2:2010