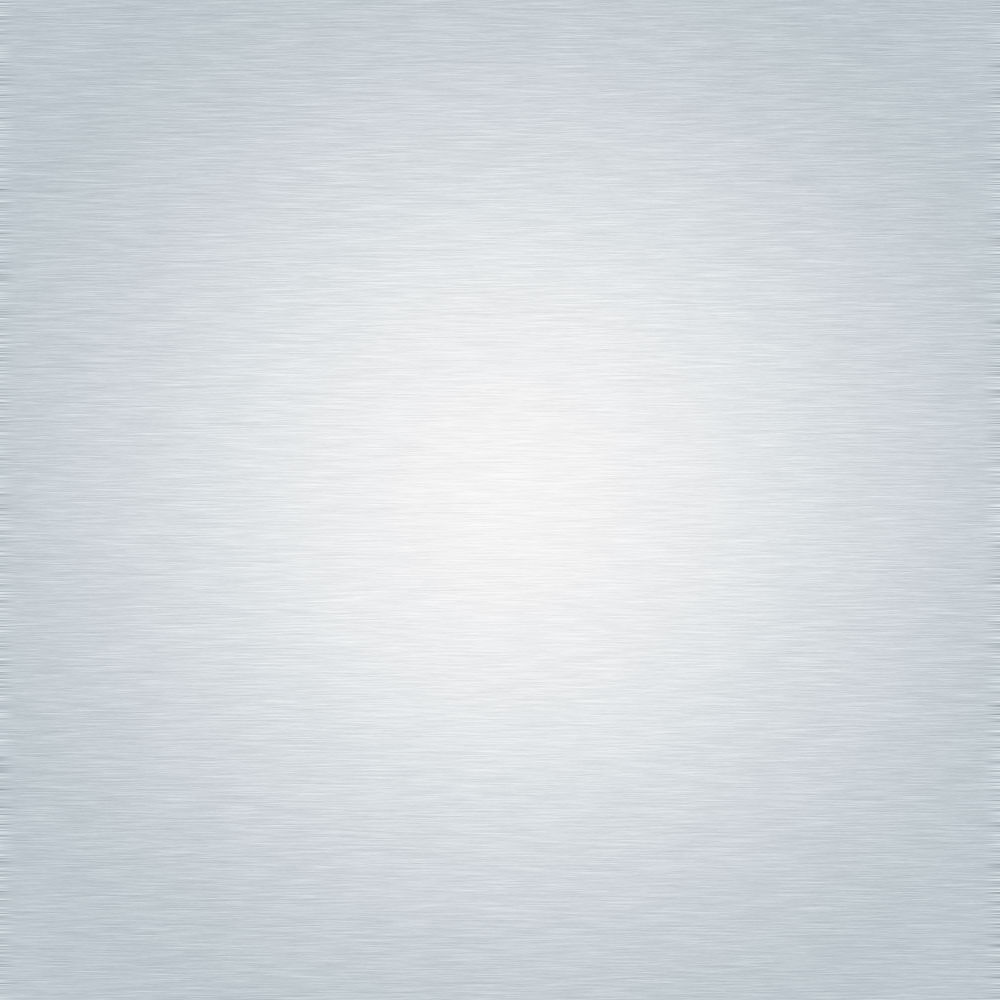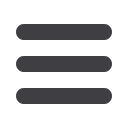
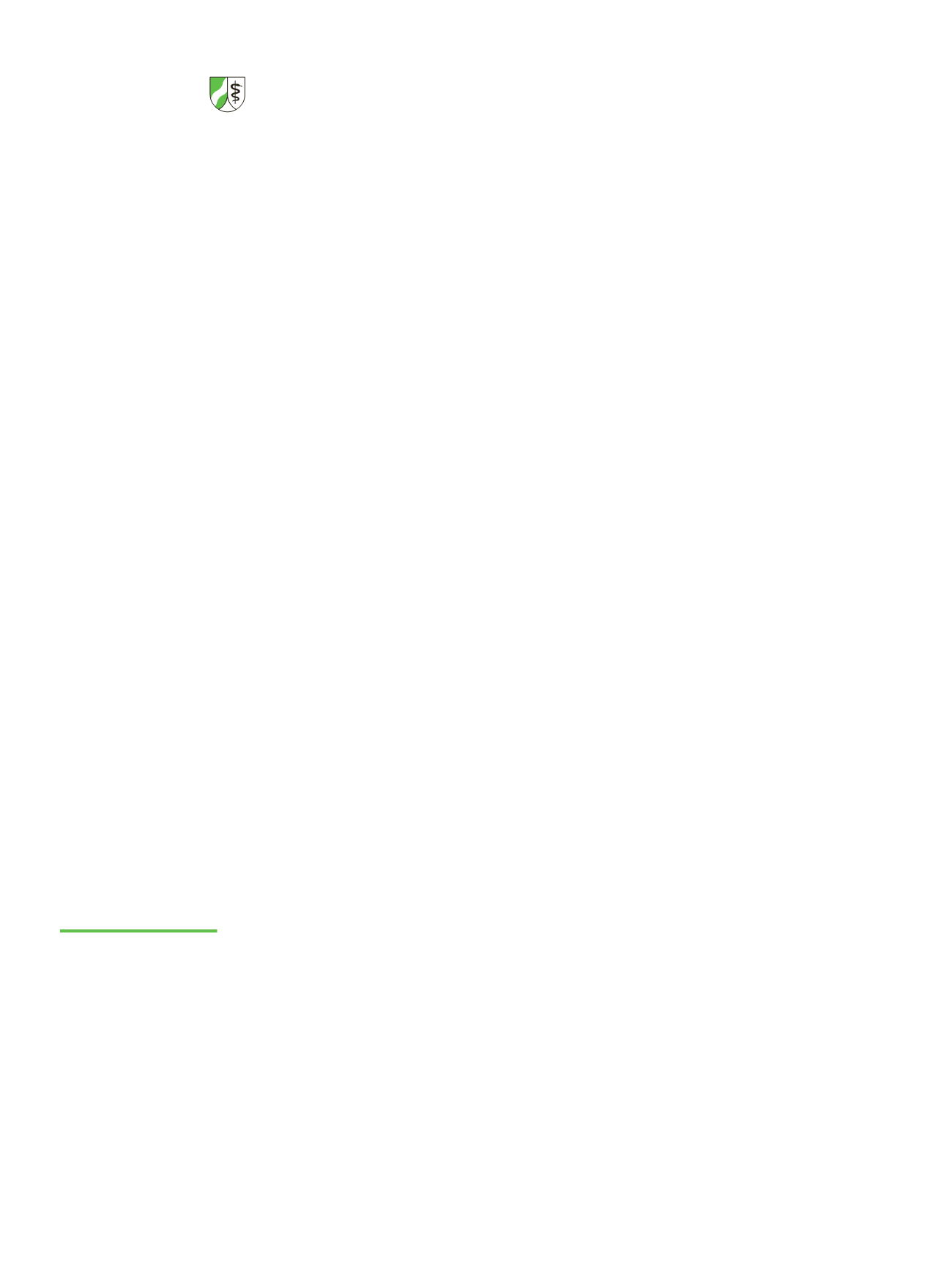
34 |
Jahresbericht 2014
Ärztekammer
Nordrhein
Allgemeine Fragen der Gesundheits-, Sozial- und Berufspolitik
Kollege bleibt viel länger und ist engagiert, und
du willst schon nach Hause?“ Dabei habe der Ober-
arzt die unterschiedlich ausgeprägte Leistungsbe-
reitschaft unter den Kollegen während der Visite
nicht gewürdigt. Eine solche Anwesenheitskultur
aber werte die Tätigkeit von Ärztinnen und Ärzten
ab, die Teilzeit arbeiten. Die Folge laut Köhne: „Wer
als Teilzeitkraft erfolgreich sein will, muss in 30
Stunden mehr leisten als jemand, der 50 Stunden
im Betrieb ist.“
Köhne kritisierte, dass Ärztinnen und Ärzte, die
ihre Weiterbildungsabschnitte in Teilzeit absolvie-
ren möchten, dieses bei der Ärztekammer vorher
anmelden und auch begründen müssen. „Warum
muss man sich überhaupt rechtfertigen?“ Auch
der Passus der Weiterbildungsordnung, dass die
Teilzeitweiterbildung „hinsichtlich Gesamtdauer,
Niveau und Qualität den Anforderungen an eine
ganztägige Weiterbildung entsprechen“ müsse,
suggeriere, dass diese gegenüber einer Weiterbil-
dung in Vollzeit weniger wertvoll sei.
Gleich in doppelter Hinsicht experimentierfreu-
dig ist Raphael Schwiertz: Zum einen hat er als
inzwischen dreifacher Vater viele unterschiedliche
Wege ausprobiert, Familie und Beruf zu leben. Zum
anderen ist er der derzeit bundesweit wohl einzige
Väterbeauftragte einer Uniklinik. Männer sähen
sich traditionell in der Rolle des Ernährers, sagte
Schwiertz. Zunehmend nähmen sie auch die Rol-
le an, aktiv an der Erziehung teilzunehmen. Vie-
le Kollegen treibe die Sorge um, mit dem Wunsch
nach mehr Zeit für die Familie einen Karriereknick
zu erleiden oder nicht mehr genug zu verdienen, um
den Lebensstandard, nun mit einem oder mehreren
Kindern bei gleichzeitigem Verdienstausfall der
Partnerin, zu halten.
Seit 2010 berät Schwiertz an der Uniklinik Essen
zum Beispiel über die Elternzeit, stellt seinen Kol-
legen Fortbildungsangebote während dieser Auszeit
oder das Wiedereingliederungskonzept der Klinik
nach der Familienphase vor. Simpel und doch pfif-
fig: Ärztinnen und Ärzte können an der Uniklinik
aus der Kantine auch Essen für die Familie mit nach
Hause nehmen. Entscheidend für die Vereinbarkeit,
so Schwiertz, sei ein familienbewusstes Verhalten
von Führungskräften: Nur wenn diese den Wunsch
ihrer Kollegen, Beruf und Familie in Balance zu brin-
gen, respektierten und aktiv unterstützten, könnten
Instrumente wie die Elternzeit nachhaltig wirken.
Von den Bedürfnissen einer neuen Mediziner-
generation berichtete Friederike Jahn, Koordina-
torin des Projekts „Freundilie – Für Freunde und
Familie“ der Bundesvertretung der Medizinstudie-
renden in Deutschland (bvmd). Ihre Generation,
die sogenannte Generation Y der in der zweiten
Hälfte der 1980er geborenen Jungen und Mädchen,
sei weltoffen, selbstbewusst und ehrgeizig, wolle
Verantwortung übernehmen, lebe den Teamgeist
und habe eine gute medizinische Ausbildung ge-
nossen. Entsprechend anspruchsvoll sei ihre Ge-
neration, wenn es um die Bedingungen für eine
kurative Tätigkeit in Klinik oder Praxis geht: So
seien flache Hierarchien, Feedback und Coaching,
Zeit für Hobbies, Freunde und Familie, moderne
Arbeitszeitmodelle und die Bereitschaft von Vorge-
setzten, auf Fragen konstruktive und respektvolle
Antworten zu geben, für sie und ihre Kommilitonen
essentiell. Und zu den Ansprüchen ihrer Generation
gehöre es eben auch, den Arztberuf, Notfälle und be-
sondere Situationen ausgenommen, wie Menschen
in anderen Berufen auch im Tagesrhythmus von
acht Stunden ausüben zu können, führte Jahn aus.
Dr. Christiane Friedländer,
seit 1980 in Neuss als HNO-Ärztin niedergelassen, berichtete
von ihren Strategien, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. So habe sie sich
für eine Facharztlaufbahn entschieden, ummöglichst wenig Hausbesuche machen zu
müssen. Als positiv habe sich auch ihre Entscheidung erwiesen, Praxis und Wohnung in
einem Haus zu vereinen. Als ihre eigene Arbeitgeberin sei sie auch zeitlich fast immer in
der Lage gewesen, spontan auf private Anlässe zu reagieren. Insgesamt könne sie emp-
fehlen, über eine Tätigkeit in Einzelpraxis als Berufslaufbahn ernsthaft nachzudenken.
Dr. Arndt Berson,
Hausarzt in einer Berufsausübungsgemeinschaft in Kempen, betonte
ebenfalls die Vorteile, die die Tätigkeit als eigener Chef, bei aller Verantwortung und
zeitlichen Belastung, mit sich bringt. Zwar erreiche er die übliche Wochenarbeitszeit von
38,5 Stunden oft bereits nach drei Tagen. „Auch ich hätte manchmal gern mehr Frei-
zeit“, so Berson. Mit der Anstellung einer zusätzlichen Kollegin wollten seine Praxispart-
nerin und er nun aber die Option erhalten, wenigstens einen Nachmittag in der Woche
frei zu nehmen. Dennoch bereue er die Niederlassung nicht. „Ich habe schätzen gelernt,
welche Gestaltungsmöglichkeiten man als eigener Chef hat“, sagte das Vorstandsmit-
glied der Ärztekammer Nordrhein.
Die Lösung, die Arbeit und ihr erstes Kind unter einen Hut zu bringen, bestand für die
Hausärztin
Dr. Raphaela Schöfmann
in der Hilfe ihrer Mutter. Sie übernahm in den ersten
beiden Lebensjahren die Betreuung, während Schöfmann in der Klinik arbeitete. Eine
weitere Strategie: Statt den Facharzt für Innere Medizin anzustreben, entschied sich die
seit 2009 in Kempen angestellte Allgemeinärztin dafür, ihre Weiterbildung in der Allge-
meinmedizin zu absolvieren, ummöglichst schnell in einer Praxis geregelte Arbeitszei-
ten zu haben, ohne die in Kliniken üblichen Dienste. „Als angestellte Ärztin kann ich mich
fast nur auf die ärztliche Tätigkeit konzentrieren“, zog die inzwischen dreifache Mutter
eine positive Bilanz.
Michael Lachmund,
angestellter Radiologe amMVZ RNR am Sana-Klinikum Remscheid,
äußerte Motive, die bisher in Einzelniederlassung tätige Kollegen für eine Tätigkeit in
einemMedizinischen Versorgungszentrum anführten: dazu zählen der Wunsch nach Auf-
gabe der unternehmerischen Tätigkeit und Abgabe des Investitionsrisikos, nach Reduk-
tion der zeitlichen Belastungmit Führungsverantwortung oder der Wunsch nach der Tätig-
keit imTeam. Für Kollegen, die aus der Klinik in einMVZ wechseln, stelle nach der statio-
nären Tätigkeit nun jene imambulanten Umfeld oft eine Bereicherung dar, sagte Lachmund.
Beispiele aus der Praxis