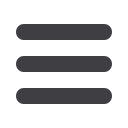

21
Herausforderungen durch die kulturelle Prägung von nichtsprachlichen Zeichen
Auch wenn Paul Ekman (2004) nach seinen langjährigen, kulturübergreifenden Studien schlüs-
sig darstellen konnte, dass die von ihm beschriebenen sieben Basis-Emotionen – Fröhlichkeit,
Wut, Ekel, Furcht, Verachtung, Traurigkeit und Überraschung – bei allen Menschen in gleicher
Weise erkannt und ausgedrückt werden, kann die nichtsprachliche Kommunikation nicht als
universell angesehen werden. Nichtverbale Kommunikation ist gemäß Ekman zu «wesentlichen
Teilen kulturspezifisch überformt», womit Schwierigkeiten bei der interkulturellen Begegnung
vorprogrammiert sind.
Gestik kann in einer Kultur konventionell sein und etwas ganz Bestimmtes bedeuten, in einer
anderen aber nicht. So werden in Bulgarien und in der Türkei sowohl das Kopfschütteln wie auch
das Nicken für ein Ja verwendet – je nach Zusammenhang. Zudem spielt es eine Rolle, mit wel-
cher Intensität es angebracht wird und ob das Kopfschütteln oder Nicken schnell oder langsam
erfolgt.
In Japan wiederum ist Lachen oft nicht Ausdruck von Freude, sondern von Verlegenheit, was
auf Nichteingeweihte irritierend wirken kann. Auch der direkte Blickkontakt mit dem Gesprächs-
partner kann sehr divergierenden Regeln unterworfen sein: In der westlichen Kultur «gehört es
sich», im Gespräch den direkten Blickkontakt zu halten, in anderen Kulturen hingegen ist dieser
verpönt – so darf etwa eine Frau aus dem Vorderen Orient nur ihrem Mann direkt in die Augen
schauen.
Literatur
Argyle M.: Körpersprache und Kommunikation. Junfermann, Paderborn 2005.
Ekman P.: Gefühle lesen – Wie Sie Emotionen erkennen und richtig interpretieren. Spektrum Akademischer Verlag, München 2004.
Heringer H.J.: Interkulturelle Kommunikation. Grundlagen und Konzepte. Francke, Tübingen und Basel 2010.
Maletzke G.: Interkulturelle Kommunikation: zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen. Westdeutscher Verlag, Opladen 1996.
1.5. Dokumentation des Gesprächs
Ein oft vernachlässigter, jedoch wesentlicher Aspekt einer professionellen Begegnung zwischen
Arzt und Patient ist die Dokumentation. Vor allem in Polikliniken und Ambulanzen, in denen
die betreuenden Ärzte häufig wechseln, aber auch in Gemeinschaftspraxen ist die kontinuier-
liche Betreuung durch einen ganz bestimmten Arzt nicht immer gewährleistet. Daher kommt der
schriftlichen Informationsübergabe, die mittlerweile oft in elektronischer Form erfolgt, eine ent-
scheidende Bedeutung zu.
Grundlagen der Kommunikation
Ärztekammer
Nordrhein



















