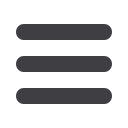

24
Gesprächstechniken
2.1. Festlegen von Zeitgrenzen und Themen
Gerade bei einem Patienten, der die Abläufe in einer Praxis oder in einer Ambulanz noch nicht
kennt, ist es hilfreich, gleich zu Beginn anzusprechen, wie viel Zeit zur Verfügung steht. Falls
der Arzt bereits eine fixe Agenda hat, sollte er dies am Anfang mit dem Patienten besprechen
und klären, welche Punkte der Patient seinerseits besprechen möchte. Ein solcher Einstieg in
das Arzt-Patienten-Gespräch ist bereits eine Chance für eine gemeinsame Entscheidungsfindung.
Während des Gespräches findet immer wieder ein Wechsel zwischen patienten- und arztzen-
trierter Gesprächsführung statt; dies folgt imIdealfall demAusmaß der Konkretisierung ärztlicher
Hypothesen: Wenn die patientenzentrierte Gesprächsphase ausreichend Material generiert hat,
umHypothesen zu formulieren, werden diese in einemarztzentrierten Gesprächsabschnitt verifi-
ziert, münden unter Umständen in weiterführende Hypothesen ein, die dann in einemwiederum
patientenzentrierten, allerdingsmehr fokussierten Gesprächsteil vomPatienten aufgegriffen und
weitergeführt werden. Dieser Wechsel bedingt unterschiedliche Redestile des Patienten, der zwi-
schen freier Rede im Narrativ und kurzer, präziser Rede im Bericht hin- und herwechselt. Diese
Abschnitte sollten dem Patienten als Themen- und Stilwechsel bekanntgegeben werden, damit
er sich in seinem Sprachduktus entsprechend verhalten kann.
2.2. WWSZ-Techniken
Mit dem Akronym WWSZ werden vier typische Techniken der patientenzentrierten Gesprächs-
führung beschrieben: das
W
arten, das
W
iederholen und das
S
piegeln, um den Raum zu öffnen
beziehungsweise offenzuhalten. Das
Z
usammenfassen dient zum einen der Qualitätskontrolle
des Arztes und zum anderen hilft es, den Gesprächsablauf zu strukturieren.
Beim
Warten
besteht die große Herausforderung darin herauszufinden, wie lange eine Pause
dauern darf, ohne dass eine bedrückende Stille entsteht. Eine Faustregel besagt, dass Pausen bis
zu drei Sekunden Länge nicht als unangenehm erlebt werden. Damit die Pause beziehungsweise
das Warten als Einladung verstanden wird, muss die Aufmerksamkeit des Arztes auf den Pati-
enten ausgerichtet bleiben, was sich vor allem durch Augenkontakt manifestiert.
Selbstverständlich hat eine Pause noch andere rhetorische Funktionen, die sich auch in der Arzt-
Patienten-Kommunikation einsetzen lassen. Die erste Funktion des Wartens ist die Einladung:
Ärztekammer
Nordrhein



















