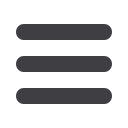

25
Der Patient erhält die Möglichkeit, in Ruhe darüber nachzudenken, ob er noch mehr sagen kann
oder wie er sein Anliegen formulieren möchte. Das gleiche Recht kann allerdings auch der Arzt
beanspruchen, wenn er nach einer überraschenden oder besonders beeindruckenden Patienten-
äußerung eine Pause entstehen lässt, in der er das Gehörte verarbeiten möchte. Wenn er seinen
Eindruck formuliert, sollte er darauf achten, dass die eigene Betroffenheit nicht so viel Raum
einnimmt, dass der Patient seinen eigenen Erzählduktus nicht mehr fortsetzen kann.
Die beiden folgenden Funktionen stammen aus der rhetorischen Werkzeugkiste: Pausen dienen
dem Hochstufen von Äußerungen, indem sie entweder vorangegangene oder nachfolgende
Äußerungen bedeutsamer erscheinen lassen. Besonders auffallend wird das Fehlen einer hoch-
stufenden Pause im Anschluss an eine Äußerung, mit der der Arzt sein Mitgefühl gezeigt hat,
zum Beispiel mit einem Satz wie:
«Ich kann sehr gut verstehen, dass Sie das sehr beeinträch-
tigt.»
Wenn diese Äußerung ohne Pause gefolgt wird von einer Überleitung zum nächsten Thema
(«Jetzt wüsste ich gerne noch, wie Ihnen die neuen Tabletten bekommen»)
, wird die erste Äuße-
rung entwertet, sie wird tiefer gestuft.
Beim
Wiederholen
werden Worte wiederholt, die der Patient gerade geäußert hat; dies ist nur
dann sinnvoll, wenn ein stockender Redefluss wiederbelebt werden soll:
Patientin.:
«Na ja, und dann meinte mein Mann, ich solle doch mal mit Ihnen darüber reden,
ob das vielleicht vom Herzen kommen könnte.»
P.: Schaut den Arzt an und schweigt. [Offenkundig erwartet sie jetzt eine Aktion des Arztes]
Arzt.:
«Vom Herzen?»
P.:
«Na ja, weil es bei ihmmit demHerzen ganz ähnlich angefangen hat. Der hatte auch immer
so ein Kältegefühl im Unterkiefer und so einen Druck in der Brust, und hinterher war’s dann
ein richtiger, großer Herzinfarkt.»
Beim
Spiegeln
greift der Arzt etwas von dem auf, was er von der Patientin gehört oder wahr-
genommen hat. Der Begriff impliziert, dass tatsächlich nur das zurückgemeldet wird, was von der
Patientin in den Diskurs eingebracht wurde.
A.: «
Und jetzt machen Sie sich auch Sorgen, dass es bei Ihnen etwas Schlimmes sein
könnte …?»
[Spiegeln auf Emotion; Benennen der Emotion]
P.:
«Ja, es kommt noch dazu, dass meine Mutter in einem ähnlichen Alter wie ich,
so ungefähr Mitte 50, im Urlaub auf Mallorca aus heiterem Himmel eine Herzattacke hatte;
da sind die dann ganz schnell mit einem Ambulanzflugzeug wieder nach Hause gekommen,
und die Ärzte haben gesagt, dass sie nochmal richtig Glück hatte.»
A.:
«Na, da kann ich gut verstehen, dass Sie sich Sorgen machen.»
[Verständnis zeigen für Emotionen]
Gesprächstechniken
Ärztekammer
Nordrhein



















