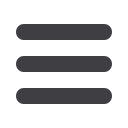

36
Heranführen an spezifische Gesprächssituationen
3.1. Erstgespräch
Der erste Kontakt mit einem anderen Menschen birgt die große Chance, sich einen ersten Ein-
druck zu verschaffen. Mit diesem Begriff ist das umfassende und im Einzelnen nicht zu erklären-
de Phänomen angesprochen, dass wir oft einen eindeutigen Eindruck vom Anderen haben, der
weit über das hinausgeht, was wir an einzelnen Fakten von ihm wissen. Ein typisches klinisches
Anwendungsbeispiel wird vor allem Pädiatern vertraut sein: Dass ein Kind krank ist, kann
spürbar sein, ohne dass sich dieser Eindruck so einfach wie in der Erwachsenenmedizin mit
einem Laborbefund oder einem bildgebenden Verfahren verifizieren ließe.
In der tiefenpsychologischen Psychotherapie wird diesem ersten Eindruck große diagnostische
Bedeutung beigemessen: Es gilt, dass im ersten Eindruck atmosphärisch und szenisch wie in der
Overtüre eines Musikstücks bereits im Kleinen alle wichtigen Themen des Patienten dargestellt
sind. Hierfür ist es aber notwendig, dass sich dieser erste Eindruck entfalten kann und dem Pati-
enten zu Beginn des Gesprächs möglichst viel Raum gegeben wird.
Im idealtypischen Erstgespräch lassen sich zwei grundlegend verschiedene Modi unterscheiden:
• Phasen, in denen der Arzt nicht weiß, worum es geht, in denen er keine Hypothesen zur Art
des Problems formulieren kann, geschweige denn zur weiterführenden Diagnostik.
• Phasen, in denen er Hypothesen hat, die er durch gezieltes Explorieren überprüft.
Um Hypothesen zu generieren, sind gezielte Fragen sinnlos, denn das Ziel ist nicht bekannt. Hier
ist es angebracht, dem Patienten einen Erzählraum zu öffnen, zum Beispiel mit der unter 2.2
beschriebenen TechnikWWSZ. UmHypothesen zu überprüfen, sind gezielte Fragen geeignet, die
der Präzision oder Unschärfe der Arbeitshypothese angemessen sein sollten.
Beispiele:
•
Die Frage «Haben Sie in letzter Zeit vermehrt Probleme beim Atmen gehabt?» zielt eher auf
eine sich verschlechternde Herz- oder Lungenfunktion.
•
Die Frage «Haben Sie denn die Wassertabletten in letzter Zeit nicht mehr so regelmäßig
genommen?» zielt punktgenau auf vermutete Probleme mit der Therapietreue.
•
Ein besonderes Problem ergibt sich bei kontinuierlichen Kontakten beim Hausarzt oder bei
Visiten bei längerem stationärem Aufenthalt, weil Ärzte dazu neigen anzunehmen, sie wüss-
ten, was sie bei einem Patienten erwarten können. Es wäre hilfreich, jedes Gespräch, in dem
Ärztekammer
Nordrhein



















