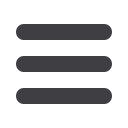

34 |
Jahresbericht 2016
Ärztekammer
Nordrhein
Allgemeine Fragen der Gesundheits-, Sozial- und Berufspolitik
Es war ein kleines Jubiläum: Zum fünften Mal
hatte der AusschussÖffentlichesGesundheitswesen,
Suchtgefahren und Drogenabhängigkeit der Ärzte-
kammer Nordrhein Vertreter verschiedener Profes-
sionen ins Düsseldorfer Haus der Ärzteschaft ein-
geladen, um über das Thema Kindergesundheit
aus unterschiedlichen Perspektiven zu debattieren.
„Mit unseren Kolloquien möchten wir dazu bei-
tragen, Präventionsansätze unterschiedlicher Ak-
teure auf kommunaler, Landes- und Bundesebene
bekannt zu machen, in einen interprofessionellen
Dialog einzutreten, um darüber zu einem besseren
und vernetzten Arbeiten zu kommen“, sagte Ulrich
Langenberg, Geschäftsführender Arzt der Ärzte-
kammer Nordrhein, zur Begrüßung der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer.
„In Deutschland sinkt die Kinderarmut trotz gu-
ter Konjunktur nicht. In NRW sind über 600.000
Kinder und Jugendliche von Armut betroffen und le-
ben mit ihren Familien unterhalb der Armutsgren-
ze“, erläuterte Univ. Professor Dr. Ertan Mayatepek,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder-
und Jugendmedizin (DGKJ), in seinem Grußwort
die Ausgangslage, von der Prävention für Kinder
aus gedacht werden müsse. Mit
der sozialen Lage seien viele Er-
krankungen und Entwicklungs-
störungen verbunden. Um gezielt
Prävention planen zu können,
brauche es Daten, die die Zusam-
menhänge und Ursachen für die
jeweiligen Gesundheitsstörungen
beschrieben.
Daten für Taten
Diese Daten lieferte für die
Bundesebene Professor Dr. Bärbel-
Maria Kurth, Leiterin der Abtei-
lung für Epidemiologie und Ge-
sundheitsberichterstattung
am
Berliner Robert Koch-Institut. Sie
stellte Daten aus der Basiserhebung
(2003–2006) und der „Welle 1“ (2009–2011) des
Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KIGGS) vor.
Daten aus beiden Studien zeigten unter anderem,
dass das Risiko für einen nur mittelmäßigen bis
sehr schlechten Gesundheitszustand bei Jungen und
Mädchen mit niedrigem sozioökonomischen Sta-
tus um das 3,4- beziehungsweise 3,7-fache im Ver-
gleich zu Kindern mit hohem sozioökonomischen
Status erhöht war. Kinder und Jugendliche aus
Familien mit niedrigem sozialen Status waren öfter
von ADHS betroffen, trieben seltener Sport, waren
häufiger übergewichtig und nahmen seltener an
Vorsorgeuntersuchungen teil. Erwähnenswert sei
in diesem Zusammenhang aber auch, dass unter-
schiedliche Schultypen gesundheitliche Risiken
ändern könnten. So zeigten die Daten, dass sich die
Gesundheitschancen von Jugendlichen aus Familien
mit niedrigem Sozialstatus verbesserten, wenn sie
ein Gymnasium besuchten. Hier müssten noch die
Wirkmechanismen untersucht werden, um sinn-
volle präventive Ableitungen zu ziehen.
Ergänzend zu den KIGGS-Daten steuerte Profes-
sor Dr. Matthias Richter, Direktor des Instituts für
medizinische Soziologie an der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, Da-
ten aus der internationalen „Health
Behaviour in School-aged Children
(HBSC) Studie derWeltgesundheits-
organisation WHO“ von 2013/2014
bei. Eines der Ergebnisse dieser Stu-
die sei, dass der Anteil rauchender
Jugendlicher zwar in den vergange-
nen Jahren deutlich abgenommen
habe, dass aberMädchenund Jungen
mit niedrigem familiären Wohl-
stand etwa doppelt so häufig täglich
rauchten wie Jugendliche mit mitt-
lerem oder hohem familiären Wohl-
stand. Auch variierte der regelmäßi-
ge Tabakkonsum je nach Schultyp.
Weitere Fakten der HBSC-Studie
können in den Faktenblättern unter
www.gbe-bund.deeingesehenwerden.
Daten zur Kindergesundheit sind Spiegel
sozialer Ungleichheit
Im Juni 2016 fand das fünfte Kammerkolloquium zur sozialen Situation und Gesundheit
von Kindern und Jugendlichen statt. Auf Basis epidemiologischer Daten zur Kinder- und Jugend-
gesundheit debattierten die Referenten und Teilnehmer über die Möglichkeiten der Prävention
zur Vermeidung von Ungleichheit.
















