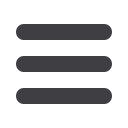

Ärztekammer
Nordrhein
Jahresbericht 2016
| 37
Allgemeine Fragen der Gesundheits-, Sozial- und Berufspolitik
punkten Onkologie und Hämatologie, Immuno-
logie, HIV/Aids und Intensivmedizin. Den neuen
Kammermitgliedern präsentierte Diehl seine Refle-
xionen zu der Frage: „Kann der Arzt Hoffnungs-
träger sein?“ Kann er, wie Diehl es formulierte,
„Vermittler dieses wichtigsten Prinzips des Lebens“
sein, des Prinzips Hoffnung? Diehl beantwortete
diese Frage für sich mit einem klaren Ja: „Ich habe
dieses beglückende Gefühl erlebt, aus einer fun-
damentalen Hoffnung zu leben und durch mein
Handeln, mein Wissen und meine Kompetenz als
Mensch und Arzt anderen hilfesuchenden oder so-
gar hoffnungslosen Menschen Hoffnung weiterzu-
geben und Vertrauen zumWeiterleben zu schaffen.“
Dies sei aber weniger als „spontane eigene Leis-
tung“ zu begreifen, sondern vielmehr als „Gnade“,
„Fügung“ und „Konsequenz einer Serie von Ereig-
nissen und persönlichen Entwicklungen.“ Wenn
ein Arzt – trotz aller medizinischen Fortschritte
der vergangenen 30 Jahre – umgeben ist von Leid
und Tod, kann das nach Diehls Worten zu „Ausge-
branntsein“, „Menschenfurcht“ und Verzweiflung
führen: „Das ist eine extreme Aufgabe, die nicht
jeder meistern kann.“ Dennoch gebe es Wege, „trotz
aller Anfechtungen und Mutlosigkeiten für unsere
Patienten Hoffnungsträger zu sein“.
Der Arzt könne Vertrauen schaffen und Trost
geben durch sein Verhalten, seine medizinische
Kompetenz und seine persönliche Glaubhaftigkeit.
Er könne sich als empathisch mitfühlender – nicht
sentimental mitleidender – Mensch solidarisch mit
dem Patienten zeigen. Der Patient erwarte Geduld,
Ehrlichkeit und die Fähigkeit, zuhören zu können.
Dagegen könne der Arzt dem Patienten seine Ängste
nicht nehmen und durch Hoffnung ersetzen, indem
er Probleme relativiere oder kleinzureden versuche.
„Hoffnung muss in einen Plan eingebettet sein, in
eine für den Patienten ersichtliche und erfahrbare
klare Strategie“, sagte Diehl, „nebulöse, diffuse, für
den Patienten unverständliche und schwer fassbare
Konzepte sind für den verzweifelten und entwur-
zelten Patienten keine Hilfe und Orientierung.“
Wichtig sei es auch, den Patienten im Sinne der
„Salutogenese“ aktiv in den „Plan der Hoffnung“
mit einzubeziehen und eine praktikable und ehr-
liche Antwort auf die Frage zu geben: „Was kann
ich selbst dazu tun, dass ich wieder ganz gesund
werde?“ Hoffnung sei kein Blitzereignis, so Diehl,
sondern ein „dynamischer Prozess, der sich lang-
sam in dem Patienten entwickelt.“
Für die jungen Kolleginnen und Kollegen hatte
der Emeritus auch einige praktische Hinweise mit-
gebracht, zum Beispiel: „Ein junger unerfahrener
als Individuum wahrgenommen werden, nicht als
„Prototyp einer jeweiligen Kultur“.
Als „Störfaktor“ in der Krankenversorgung wer-
den kulturelle Unterschiede allgemein überschätzt,
meint Bruchhausen: „Offenbar braucht man Kultur
als vermeintliche Restkategorie für alles, was man
nicht genauer auf den Punkt bringen kann.“ Groß-
familien in Mehrbettzimmern, Verständigungspro-
bleme und Missverständnisse – solche Probleme
lassen sich nach seiner Beobachtung „durch guten
Willen lösen“. Bruchausen: „Haben Sie keine Angst
vor kultureller Differenz.“
Eine Experten-Arbeitsgruppe habe festgestellt,
„dass die wirklich unlösbaren Konflikte aufgrund
unvereinbarer Wertvorstellungen extrem selten
und deshalb so spektakulär sind“. Die Gruppe hat
drei grundlegende Konfliktfelder identifiziert:
Erstens das Verhältnis des einzelnen Patienten zu
seiner Familie, „die über ihn bestimmen oder zu-
mindest mitentscheiden will“. Das hält Bruchhau-
sen für verständlich, denn zum Beispiel seien viele
Chinesen, Muslime oder Afrikaner mangels Kran-
kenversicherung daran gewöhnt, für die Kranken-
behandlung eines Familienangehörigen mitverant-
wortlich zu sein – auch ökonomisch.
Ein zweites essentielles Problem sieht der Medizin-
ethiker in einer „gelegentlich hartnäckigen Weige-
rung, bei erwiesener Nutzlosigkeit weiterer Inten-
sivtherapie der ärztlich indizierten Behandlungs-
begrenzung zuzustimmen“. Hintergrund sei das
Gefühl, den Familienangehörigen damit im Stich
zu lassen. Das dritte und vielleicht schwierigste Pro-
blem ist laut Bruchhausen die Stellung der Frau in
stark patriarchalischen Gesellschaften. Etwa stelle
das Verbot, vomanderen Geschlecht berührt zuwer-
den, das Gesundheitswesen auch vor organisatori-
sche Probleme. Bruchhausen tendiert hier dazu, im
Einzelfall keine Grundsatzdebatte zu führen und
solche Wünsche zu erfüllen – „aber unmissver-
ständlich klar zu machen, dass das Gesundheits-
wesen unter der deutschen Rechtsordnung mit
ihrer Gleichstellung von Mann und Frau arbeitet
und somit kein Recht auf exklusive Behandlung
durch das eigene Geschlecht bestehen kann“.
Beglückendes Gefühl
Den Festvortrag auf der elften Begrüßungsveran-
staltung im Herbst 2015 hielt Professor Dr. Volker
Diehl. Der Arzt und Wissenschaftler von internati-
onalem Rang war bis zu seiner Emeritierung 2003
mehr als 20 Jahre lang Direktor der Medizinischen
Klinik I der Universität zu Köln mit den Schwer-
















