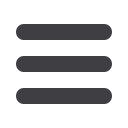

Ärztekammer
Nordrhein
Jahresbericht 2016
| 35
Allgemeine Fragen der Gesundheits-, Sozial- und Berufspolitik
Weniger Medienkonsum, mehr Bewegung
„Auch der Medienkonsum ist stark an den so-
zioökonomischen Status der Familien geknüpft“,
berichtete Professor Dr. Dr. sportwiss. Christine
Graf von der Deutschen Sporthochschule Köln.
Sie stellte Ergebnisse einer Kölner Studie aus
dem Jahr 2015 zur Bildschirmnutzung im frühen
Kindesalter vor: Eine Mediennutzungsdauer von
60 Minuten am Tag überschritten 20,9 Prozent der
ein- bis sechsjährigen Kinder. Entgegen der Emp-
fehlung noch keine Bildschirmmedien zu nutzen,
täten dies bereits 55,6 Prozent der ein- und zwei-
jährigen Kinder. Prädiktoren des Medienkonsums
von mindestens 60 Minuten wären das Alter, der
Schulabschluss der Eltern sowie der Migrations-
status. Kinder von Eltern mit einem hohen Schul-
abschluss nutzten signifikant seltener Medien für
mindestens 60 Minuten am Tag als Kinder, deren
Eltern keinen hohen Schulabschluss hatten. Mit
zunehmender Nutzung der Bildschirmmedien gin-
ge auch die Alltagsbewegung zurück. Die Empfeh-
lung der Sportwissenschaftlerin: Kinder sollten
sich im Alltag täglich mindestens 90 Minuten be-
wegen und unnötige Sitzzeiten vermeiden.
Was Kommunen wissen (sollten)
Volker Kersting, Leiter des Referats V.1. Stadt-
forschung und Statistik der Stadt Mülheim an der
Ruhr, ergänzte die vorgestellten bundesweiten Zah-
len mit Daten aus dem kommunalen Raum. Seine
für Mülheim erstellten Erhebungen aus Schulein-
gangsuntersuchungen und Daten zur Sozialraum-
struktur zeigten eindrücklich: „Nirgendwo ist es
so wie im Durchschnitt.“ Präventionsangebote
müssten die Flexibilität besitzen, sich an Gegeben-
heiten vor Ort anzupassen und bestenfalls mit den
Akteuren vor Ort gemeinsam ausgewählt und um-
gesetzt werden. Sein Plädoyer: Primärpräventive
Maßnahmen zum Beispiel von Krankenkassen mit
der Kommune gemeinsam umsetzen und sozial-
raumbezogen weiterentwickeln. Nur so könnten
die Zielgruppen tatsächlich überprüfbar erreicht
werden. Außerdem plädierte er für eine stärkere
Einbeziehung der medizinischen Versorgungsebe-
ne, beispielsweise der Kinderärztinnen und Kinder-
ärzte, zur besseren Ansprache und Erreichbar-
keit von Familien aus prekären Lebenslagen, um
möglichst frühzeitig Hilfe anbieten und präventiv
wirken zu können.
Qualitätsgeprüfte Präventionsangebote
„Wir brauchen die unterschiedlichen Daten, um
zielgruppenspezifische, qualitätsgesicherte Prä-
ventionsmaßnahmen in den einzelnen Settings an-
bieten zu können“, sagte Dr. Heidrun Thaiss,
Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung. In den Settings Kita und Schule sieht
sie die besten Chancen, die ungleichen Gesund-
heits- und Bildungschancen zu vermindern. Bislang
sei es aber so, dass viele unterschiedliche, zum Teil
konkurrierende monothematische Präventions-
angebote vor allem von Krankenkassen in den ein-
zelnen Settings angeboten würden, ohne dass für
die Kitas und Schulen Qualitätsvorteile der ein-
zelnen Angebote sichtbar würden. Auch die Nach-
haltigkeit der Angebote werde zu selten geprüft.
Das Präventionsgesetz werde dazu beitragen,
diese unterschiedlichen Präventionsangebote in
den jeweiligen Settings zu einem übergreifenden
Konzept zusammenzuführen und die zugrunde-
liegenden Qualitätskriterien transparent zu ma-
chen.
Fazit
Dr. Anne Bunte, Vorsitzende des
Ausschusses
Öffentliches Gesundheitswesen, Suchtgefahren und
Drogenabhängigkeit
und Leiterin des Kölner Ge-
sundheitsamtes, fasste in ihrem Schlusswort die
Meinung aller Referenten zusammen: „Armut und
Krankheit der Eltern wirken sich erheblich und
langfristig auf den Gesundheitszustand und die
Bildungschancen von Kindern aus.“ Doch wel-
che Hilfe welches Kind an welcher Stelle bedürfe,
könne von Kommune zu Kommune, sogar von
Schule zu Schule, von Familie zu Familie höchst
unterschiedlich sein.
Kommunale Daten wie die Schuleingangsunter-
suchungen in Kombination mit Daten zur Sozial-
raumstruktur machten den Bedarf sichtbar und
böten die Grundlage für ein gutes, vernetztes Han-
deln der Akteure. Ebenso wichtig wie die Berück-
sichtigung repräsentativer Daten als Planungs-
grundlage von Präventionsmaßnahmen seien auch
die Evaluation der Maßnahmen und deren trans-
parente Darstellung. Nur so könne gute Qualität im
Rahmen der Prävention gesichert und Prävention
weiter ausgebaut werden.
















