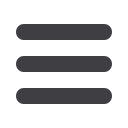

46
Weisen Befunde bei der Untersuchung von Kindern auf Gewalteinwirkungen hin, ist der Arzt ver-
pflichtet, zum Schutz des Kindes aktiv zu werden. Wichtige Handlungsschritte zum Kinderschutz
sind in Leitfäden der Landesärztekammern dargestellt, beispielsweise im Ärztlichen Leitfaden
Kinderschutz, Niedersachsen (DSKB, 2013).
Literatur
Back A.L. et al.: Efficacy of communication skills training for giving bad news and discussing transitions to palliative care.
Arch Intern Med. 2007; 167(5): 453–460.
Coker A.L. et al.: Physical and Mental Health Effects of Intimate Partner Violence for Men and Women. American Journal of Preventive Medicine.
2002; 23: 260–8.
DKSB: Ärztlicher Leitfaden Kinderschutz, 2013 unter:
(http://www.gesundheit-nds.de/CMS/images/stories/PDFs/Aerztlicher-Leitfaden-Kinderschutz_web.pdf). [Stand: 18.03.2015]
Feder G.S., Hudson M., Ramsay J., Taket A.R.: Expectations and experiences when they encounter health care professionals: a meta-analysis
of qualitative studies. Arch Intern Med. 2006; 166(1): 22–37.
HHU Düsseldorf, 2014 Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) unter:
http://mediathek.hhu.de/watch/4612929d-f0b8-4cac-9a79-36f003823995 [Stand: 19.03.2015]
Olive P.: Care for emergency department patients who have experienced domestic violence: a review of the evidence base.
Journal of Clinical Nursing. 2007; 16(9): 1736–48.
Selg H., Mees U., Berg D.: Psychologie der Aggressivität. 2. Auflage. Hogrefe, Göttingen 1997.
WHO: Umgang mit Gewalt in Paarbeziehungen und mit sexueller Gewalt gegen Frauen. Leitlinie der WHO für Gesundheitsversorgung und
Gesundheitspolitik. Signal e.V., Berlin 2014.
3.6. Ansprechen heikler Themen: Alkoholkonsum
Das Ansprechen heikler Themen verlangt das Überschreiten von Hemmschwellen, unabhängig
davon, ob über Sexualität, Sterben oder über Sucht gesprochen wird. Diese Themen haben etwas
Privates, Intimes, sodass es einer ‚Erlaubnis‘ des Betroffenen bedarf, sie ansprechen zu dürfen.
Fühlt sich der Patient überrumpelt, wird er sich schützen und verschließen. Daher ist in erster
Linie der vertraute Hausarzt geeignet, sich unter Respektierung der individuellen Eigenheit in der
Problemsphäre des Patienten zu bewegen.
Wie viel ist zu viel?
Nach aktuellen epidemiologischen Daten konsumiert die Mehrheit der erwachsenen Deutschen
keinen Alkohol oder betreibt einen risikoarmen Alkoholkonsum (Pabst et al., 2013). Von me-
dizinischer beziehungsweise psychiatrischer Relevanz sind der
riskante
, der
schädliche
und
der
abhängige
Alkoholkonsum. Der
riskante
Konsum (14,2 % der erwachsenen Bevölkerung
in Deutschland; Pabst et al., 2013) betrifft einen chronischen, (nahezu) täglichen Alkoholkon-
sum, der das langfristige Risiko körperlicher Schäden, zum Beispiel einer Leberzirrhose, erhöht,
aber zum Zeitpunkt der Diagnose noch nicht zu negativen körperlichen, psychischen oder so-
Heranführen an spezifische Gesprächssituationen
Ärztekammer
Nordrhein



















