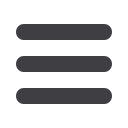

51
allen Mitteln unterstützend eingreifen. Doch auch wenn der Patient aktuell Veränderungen ab-
lehnt, sollte diese Entscheidung respektiert und der Patient als Person akzeptiert werden. Gerade
hiermit schafft der Arzt in der ärztlichen Praxis das therapeutische Klima, das es dem Patienten
erlaubt, Konflikte und Schwierigkeiten anzusprechen. Dieser gegenseitige Respekt zwischen Arzt
und Patient führt dann auch im schwierigen Bereich der Suchtbehandlung eher zu einer befrie-
digenden und Erfolg versprechenden Dialogbereitschaft und erleichtert so eine Verhaltensände-
rung.
Literatur
Adams M., Effertz T. Die volkswirtschaftlichen Kosten des Alkohol- und Nikotinkonsums. In: Singer M. V., Adams M (Hrsg.) Alkohol und Tabak:
Grundlagen und Folgeerkrankungen. Thieme, Stuttgart 2011
Aeschbach C.: Der «schwierige» Alkoholpatient. Schweiz Med Forum. 2012; 12(46): 893–6.
Di Clemente C., Prochaska J.: Toward a comprehensive, transtheoretical model of change: Stages of Change and addictive behaviors.
In: Miller W R, Heather N (Hrsg.): Treating addictive behaviors. 2nd edn. Plenum, New York 1998.
Geyer D et al. Behandlungsleitlinie Alkoholbezogene Störungen – Postakutbehandlung. In: Schmidt LG et al. (Hrsg.) Evidenzbasierte
Suchtmedizin. Deutscher Ärzteverlag, Köln, S. 52–88
Pabst A. et al. Substanzkonsum und substanzbezogene Störungen in Deutschland im Jahr 2012. Sucht 2013; 59: 321–331
Pilling S et al.: Diagnosis, assessment, and management of harmful drinking and alcohol dependence: summary of NICE guidance BMJ
2011;342:d700 doi: 10.1136/bmj.d700
Rollnick S., Mason P., Butler Ch.: Health Behaviour Change – a Guide for Practitioners. Churchill Livingstone, Philadelphia 1999.
Soyka M. et al.: Therapiesituation Alkoholabhängigkeit. Suchtmed. 2012; 14 (4): 176–7.
Spiesshofer M. et al.: Indikatoren für den Behandlungsverlauf einer stationären Entwöhnungsbehandlung Alkoholkranker.
Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie. 2011; 162(2): 66–71.
S3-Leitlinie „Screening, Diagnose und Behandlung alkoholbezogener Störungen“ AWMF-Register Nr. 076-001; Stand 28.1.2015.
www.awmf.org3.7. Gespräch mit Angehörigen von kranken Kindern
Gespräche mit Eltern von kranken Kindern weisen gegenüber anderen Arztgesprächen einige
Besonderheiten auf. In der Regel handelt es sich um
Mehrpersonengespräche
, an denen der
Arzt, die Eltern, das Kind und evtl. weitere Gesundheitsfachleute anwesend sind. Das verlangt
vom Arzt die Fähigkeit, sich gleichzeitig und flexibel auf mehrere Menschen mit unterschied-
lichen Wünschen, Ansprüchen und kommunikativen Fertigkeiten einzustellen und zudem auch
das Kind in die Gespräche miteinzubeziehen. Dafür muss es dem Arzt gelingen, eine Beziehung
zum Kind aufzubauen und die Gesprächsführung an die kommunikative Kompetenz des Kindes
anzupassen. Der Umstand, dass nicht der Patient selbst, sondern die Eltern für ihr minderjäh-
riges Kind sowohl Ansprechpartner als auch Entscheidungsträger für medizinische Maßnahmen
sind, macht die Zusammenarbeit komplex und störungsanfällig. Auch die Tatsache, dass die An-
gehörigen für ihre Kinder Entscheidungen treffen (müssen), die möglicherweise vom Arzt nicht
gutgeheißen werden (zum Beispiel Verweigerung einer notwendigen medizinischen Maßnah-
Heranführen an spezifische Gesprächssituationen
Ärztekammer
Nordrhein



















