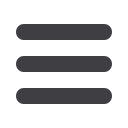

53
kranker Kinder dazu, dass sie sich auf der Suche nach Erklärungen und Ursachen oft Vorwürfe
machen, selbst schuld zu sein, etwa Krankheitszeichen zu spät erkannt zu haben. Sie suchen
nicht nur bei sich, sondern auch beim anderen Elternteil oder anderen Beteiligten nach Schuldi-
gen. Der Arzt ist also mit vielfältigen Ängsten, Befürchtungen und Fragen konfrontiert und sollte
sich daher – genauso wie in der Erwachsenenmedizin – genau überlegen, was er zu einem be-
stimmten Zeitpunkt ansprechen will.
Bei der Vermittlung von Informationen sollte berücksichtigt werden, dass viele Angehörige durch
die Erkrankung ihres Kindes emotional so aufgewühlt und betroffen sind, dass es ihnen kaum
gelingt, sich auf das Gespräch einzustellen, zuzuhören und die Informationen aufzunehmen.
Eltern krebskranker Kinder schätzen an den behandelnden Ärzten vor allem den Eindruck von
fachlicher Kompetenz; in ihrer Wahrnehmung überlagern sich fachliche Autorität und emotionale
Zuwendung. In ihrem Verhalten unterscheiden sich die Berufsgruppen deutlich: Pflegende ver-
suchen, durch explizites Aufgreifen von Sorgen und Trauer die Eltern emotional zu unterstützen,
während Ärzte sich vor allem für die Vermittlung von Informationen zuständig fühlen. Aus der
Sicht der Eltern helfen ihnen beide Berufsgruppen auf ihre eigene Art.
Das Gespräch mit Kindern und Jugendlichen
Kinder haben das Recht auf altersgemäße Information und Aufklärung über alle diagnostischen
und therapeutischen Schritte sowie den zu erwartenden Verlauf der Erkrankung. Auch wenn das
Kind noch über wenig verbale Kompetenz verfügt, sollte immer mit ihm gesprochen werden. Ab
einem Alter von etwa sieben Jahren können Kinder in medizinische Entscheidungen miteinbezo-
gen werden. Der Arzt sollte das Kind wahrheitsgetreu über seine Erkrankung informieren. Dies
fällt vielen Ärzten schwer, weil sie nicht wissen, wie sie die (komplexe) Krankheit erklären sol-
len und/oder sich vor möglichen Fragen fürchten. Aus falsch verstandenem Schonverhalten die
Kinder nicht oder gar falsch zu informieren, ist jedoch nicht hilfreich. Falschinformationen und
Schweigen sind für das Kind schlimmer als Reden, nimmt es doch meist genau wahr, wenn etwas
nicht stimmt und macht sich entsprechend seine eigenen Gedanken und Phantasien. Diese sind
oft bedrohlicher als die Realität. Es kommt zu falschen Schlüssen und Annahmen, etwa in dem
Sinne, dass es selbst für die Erkrankung verantwortlich ist. Jede Falschinformation oder Notlüge
untergräbt das Vertrauen und fördert das Misstrauen gegenüber Ärzten und Eltern, was eine wei-
tere Behandlung schwierig macht. Eine altersgerechte Information über die Erkrankung gibt dem
Kind die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich Unterstützung zu holen.
Zeichnungen und Bücher zur Illustration sind bei jüngeren Kindern zur Information wichtig. Ein
gutes Beispiel, wie Kindern die Angst vor dem Arztbesuch genommen werden kann, ist das von
Heranführen an spezifische Gesprächssituationen
Ärztekammer
Nordrhein



















