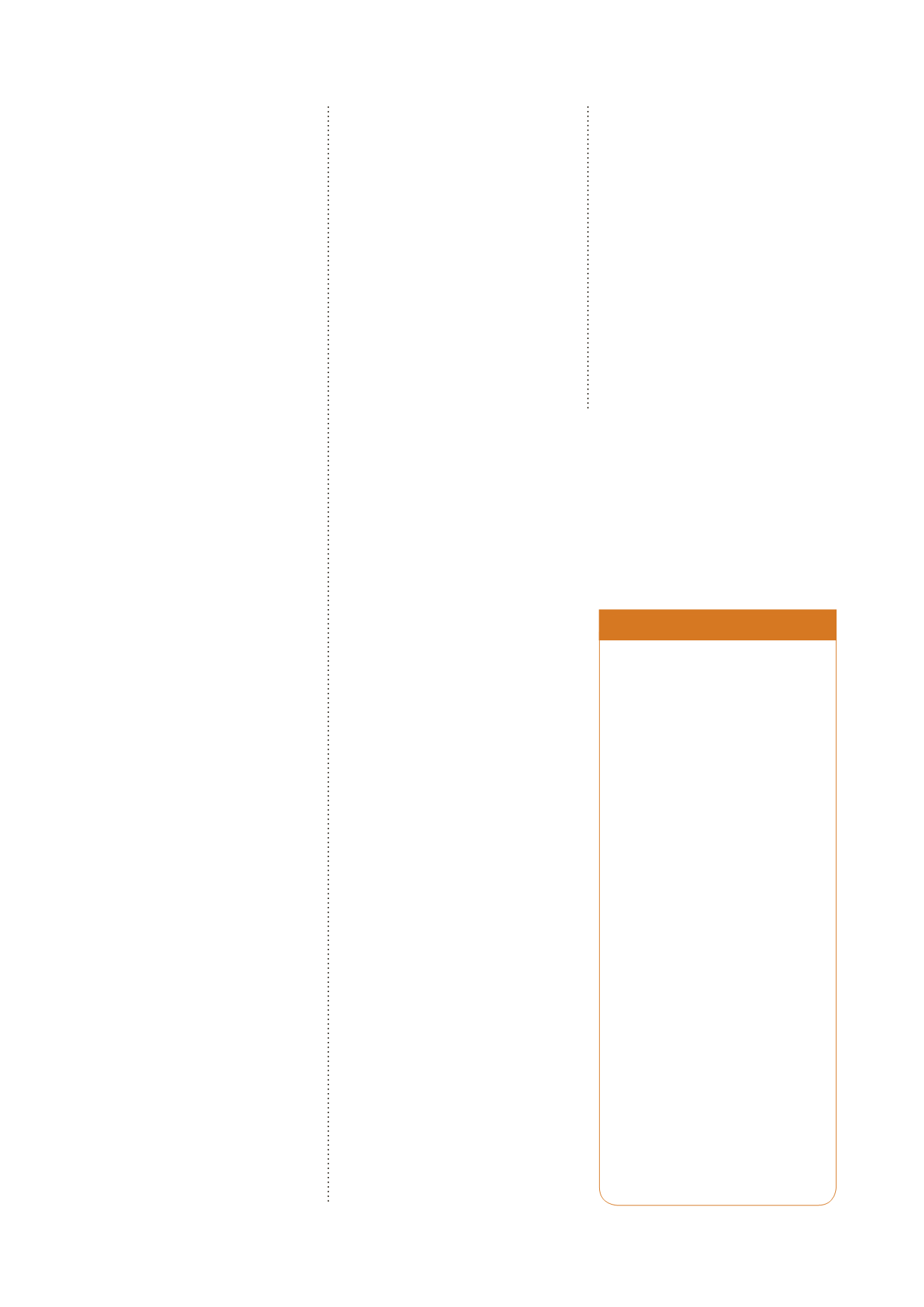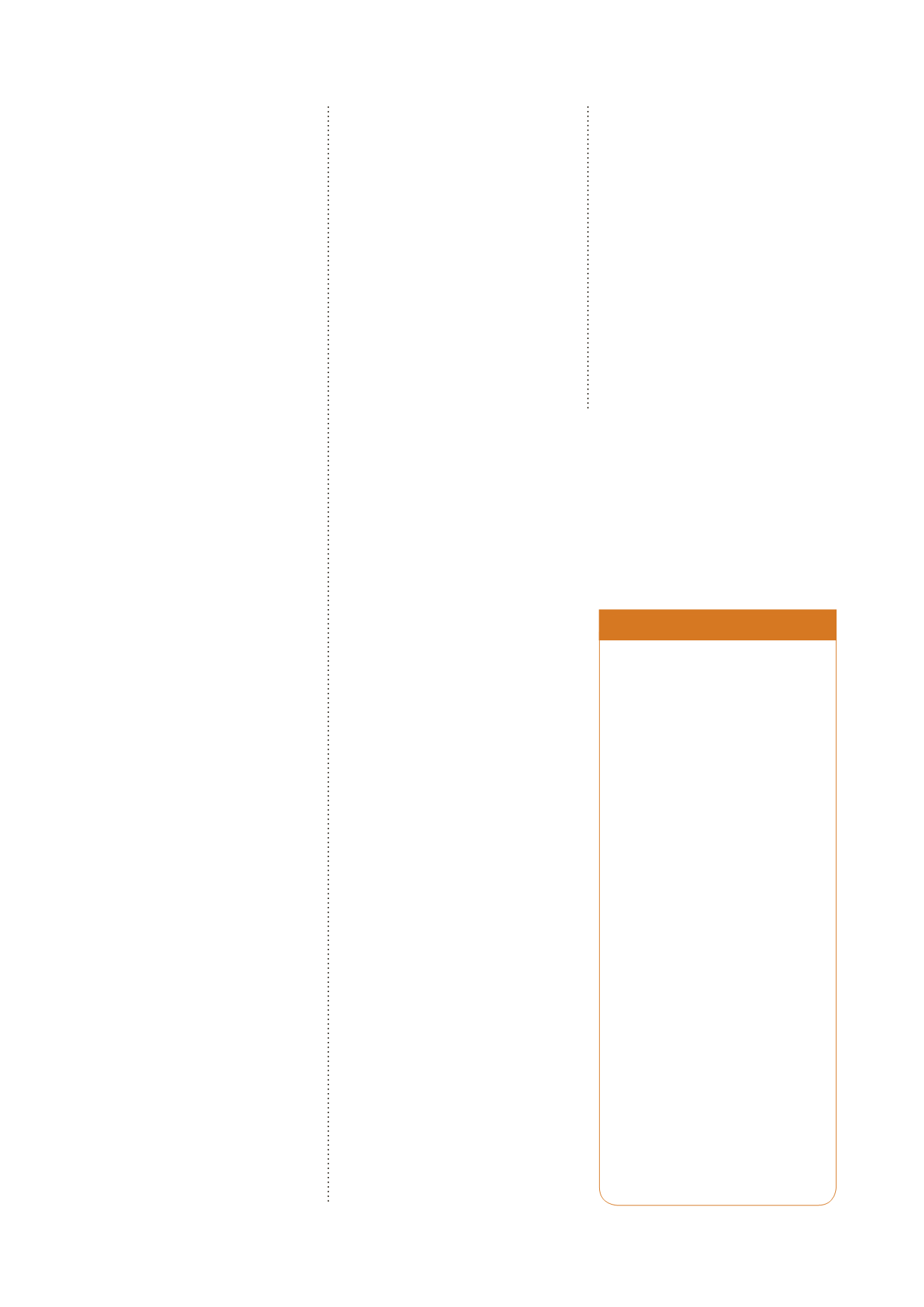
27
energie | wasser-praxis
10/2014
Energieträgern gewinnt diese Techno-
logie im Rahmen der Energiewende an
Bedeutung.
W
Literatur:
[1] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: „EEG-
Reform“,
/
Erneuerbare-Energien/eeg-reform.html, (Zugriff:
14.07.2014).
[2] Feix, O. et al.: Netzentwicklungsplan Strom 2014, Anla-
ge „Kraftwerksliste zum NEP 2014“, Stand 16. April
2014,
documents/NEP_2014_Kraftwerksliste.pdf (Zugriff:
21.07.2014).
[3] ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umwelt-
freundlichen Energieverbrauch e. V.: „BHKW-Kenndaten
2011 – Module, Anbieter, Kosten.“, Berlin, 2011.
[4] Buller, M.: „Ganzheitliche Betrachtung des Mikro-KWK
Potenzials im Wohngebäudebestand – Korrelation zwi-
schen Kraft-Wärme-Kopplung und Dämmmaßnahmen“,
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser
mbH, 2013.
die Vollwartung verhalten sich – laut
Umfrageergebnisse – proportional zur
Leistung der KWK-Systeme. Mit zuneh-
mender elektrischer Leistung der
BHKW steigen die Vollwartungskosten
(Abb. 5)
. Beispielsweise liegen die Kos-
ten für die Vollwartung von Erdgas-
BHKW in der elektrischen Leistungs-
klasse bis 10 kW stets unter 0,5 EUR/
Bh. Im Gegensatz dazu ist im höheren
elektrischen Leistungsbereich über 500
kW – gemäß den vorliegenden Daten
– annähernd der 10-fache Aufwand zu
erwarten. Die Varianz der Vollwar-
tungskosten je Betriebsstunde ist in der
analysierten Produktgruppe mit 1,5 ct
bis 12,5 EUR entsprechend groß.
Der Bezug der Vollwartungskosten auf
die elektrische Nennleistung der bewer-
teten Erdgas-BHKW zeigt, dass die Dif-
ferenz der spezifischen Vollwartungs-
kosten je kWhmit 0,6 bis 7,6 ct geringer
ist als die Kostendifferenz je Betriebs-
stunde. Die Darstellung der spezifi-
schen, auf die elektrische Arbeit bezo-
genen Vollwartungskosten verdeutlicht
darüber hinaus, dass der Aufwand für
die Vollwartung pro erzeugte kWh mit
steigender Leistung sinkt. Die spezifi-
schen Kostenfunktionen für die Voll-
wartung und die Anschaffung weisen
demnach einen kongruenten Verlauf
auf. Für die Vollwartung von BHKW ist
aktuell, bezogen auf die Datenbasis,
ein spezifischer Grundpreis von 6,5
ct/kWh zu erwarten.
Zusammenfassung und Ausblick
Aufgrund der unterschiedlichen Tech-
nologien verfügen KWK-Systeme über
verschiedene betriebstechnische und
ökonomische Eigenschaften. Durch die
große technologische Diversität sind
heute für alle Leistungsklassen und ver-
schiedenste Anforderungen KWK-An-
lagen amMarkt verfügbar. Allgemeine
Aussagen konnten im Rahmen der Da-
tenerhebung für ein elektrisches Leis-
tungsspektrum von 1 bis 2.000 kW
abgeleitet werden. Für Anwendungen
mit höheren Leistungen werden indi-
viduelle Konzepte erstellt, sodass eine
vergleichbare Auswertung für diese
Leistungsklasse nicht möglich ist.
Die zurzeit marktgängigen KWK-Syste-
me erreichen – basierend auf den Er-
gebnissen der Datenerhebung – imMit-
tel Gesamtwirkungsgrade von 90 Pro-
zent und erfüllen somit das Hocheffi-
zienzkriterium. Darüber hinaus
werden auch Wirkungsgrade über
100 Prozent erreicht, wenn Brenn-
werttechnik zum Einsatz kommt.
Durch die hohe primärenergetische
Effizienz kann der erweiterte Einsatz
von KWK-Anlagen zur Minderung
umweltschädlicher Emissionen und
zum Erreichen klimapolitischer Ziele
beitragen. Der Ausbau der KWK wird
dabei hauptsächlich von der Wirt-
schaftlichkeit der Systeme beeinflusst,
die von den Anschaffungs- und War-
tungskosten sowie den rechtlichen
Rahmenbedingungen abhängig ist.
Vor diesem Hintergrund wurde in der
hier vorgestellten Studie ein Vergleich
der Anschaffungskosten für BHKW für
die Jahre 2011 und 2013 durchgeführt.
Demnach sind die spezifischen Richt-
preise für KWK-Systeme in den ver-
gangenen zwei Jahren gesunken. Ob
sich dieser Trend in Zukunft fortsetzt
und wie Veränderungen der rechtli-
chen Rahmenbedingungen die wirt-
schaftliche Situation der BHKWbeein-
flussen werden, kann zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt nicht beurteilt wer-
den. Kostenseitig gilt aktuell, dass die
leistungsbezogenen Aufwendungen
sowohl für Einzelgeräte als auch für
Systempakete mit steigender elektri-
scher Leistung der BHKW sinken.
Ebenso verhalten sich die spezifischen
Vollwartungskosten der KWK-Systeme
für die erzeugte kWh Strom.
Durch die Bewertung der Betriebsop-
tionen anhand der An- und Abfahrzei-
ten und der Modulationsfähigkeit der
BHKW konnte der Nachweis erbracht
werden, dass KWK-Systeme heute fle-
xibel und bedarfsgerecht eingesetzt
werden können. BHKW sind techno-
logisch bereits ausgereift und weisen
ein großes Potenzial zur dezentralen
Energiebereitstellung und zur Bereit-
stellung von Regelenergie auf. Durch
die Ausgleichsmöglichkeiten der KWK
in Hinblick auf die fluktuierende
Stromerzeugung aus erneuerbaren
Nadine Lefort M. Eng.
ist Projektingeni-
eurin in der Abteilung Brennstoff- und
Gerätetechnik am Gas- und Wärme-
Institut Essen e. V.
Michael Schmidt M. Eng.
ist Teamleiter
Gerätetechnik in der Abteilung
Brennstoff- und Gerätetechnik am
Gas- und Wärme-Institut Essen e. V.
Dipl.-Ing. (FH) Maren Wenzel M. Eng.
ist Projektingenieurin in der Abteilung
Brennstoff- und Gerätetechnik Gas- und
Wärme-Institut Essen e. V.
Dr.-Ing. Rolf Albus
ist Geschäftsführen-
der Vorstand Gas- und Wärme-Institut
Essen e. V.
Kontakt:
Gas- und Wärme-Institut Essen e.V.
Nadine Lefort M. Eng.
Hafenstr. 101
45356 Essen
Tel.: 0201 3618-251
E-Mail:
Internet:
Die Autoren