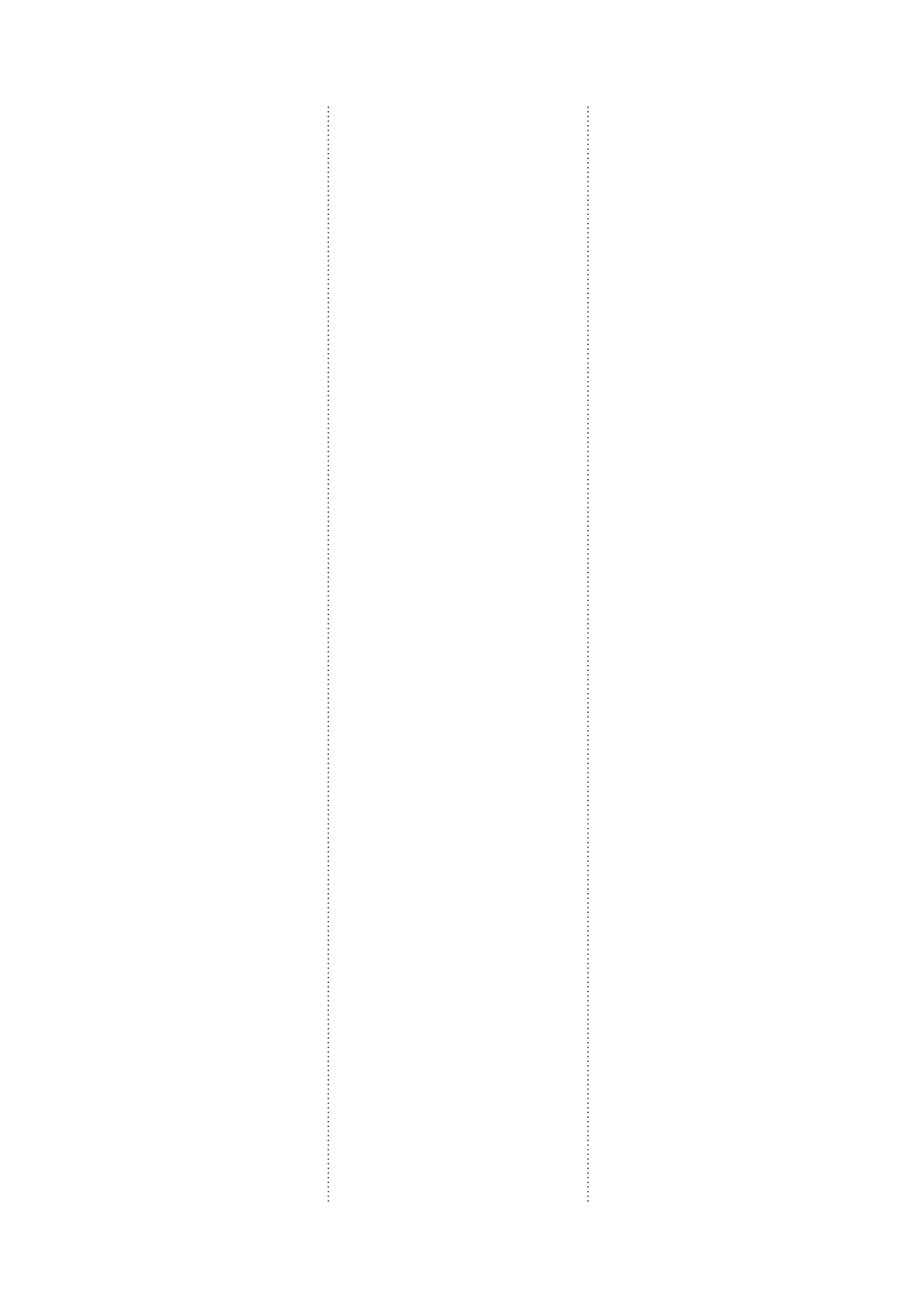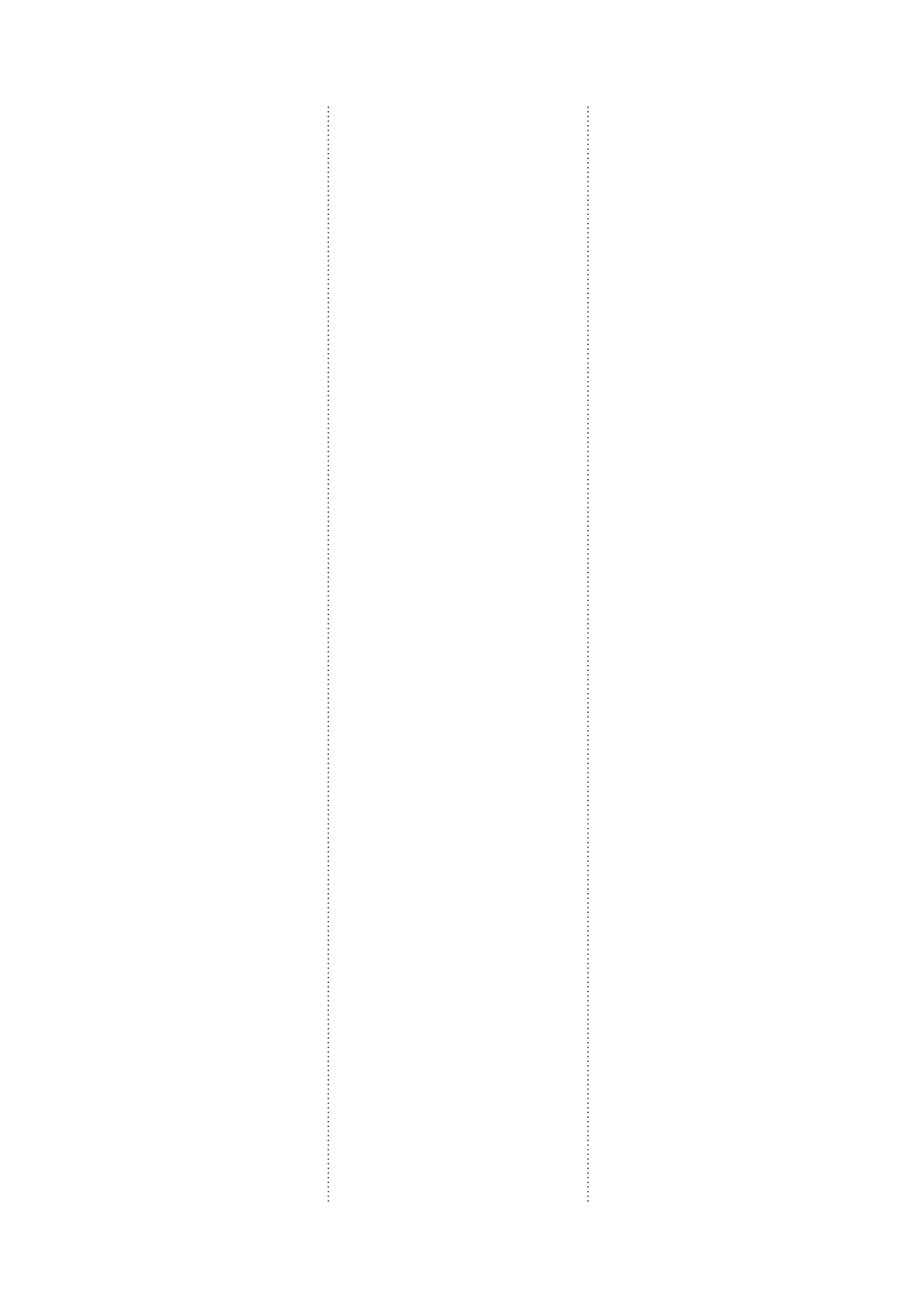
43
energie | wasser-praxis
10/2014
Trennung der Reststoffe durch den
Aufbereitungsprozess
Im Vordergrund der Planung einer
Trinkwasser-Aufbereitungsanlage ste-
hen die Trinkwasserqualität, die Wirt-
schaftlichkeit und die Betriebssicher-
heit. Daneben kann es aber auch sinn-
voll sein, Aufbereitungsschritte so
auszurichten, dass Reststoffe gezielt
separat gelagert und abtransportiert
werden können.
Abbildung 1
zeigt
den Aufbereitungsprozess eines Was-
serwerkes, in dem u. a. Enteisenung,
Entmanganung und Enthärtung statt-
finden. Aus diesen Prozessen resultie-
ren als Reststoffe:
•
Eisenschlamm,
•
Manganschlamm,
•
Kalkschlamm und
•
Kalkpellets.
Anstatt am Anfang des Aufbereitungs-
prozesses könnte die Enteisenung auch
zusammen mit der Schnellentcarboni-
sierung durchgeführt werden. Das Ei-
sen wird dann zu einem überwiegen-
den Teil in die Pellets eingebaut und zu
einem kleineren Teil über die Ablauf-
trübung zu den nachgeschalteten Trüb-
stofffiltern transportiert. Stört jedoch
der Eisenanteil in den Pellets bei einer
Verwertung oder können beide Stoffe
separat besser verwertet werden, kann
dies der ausschlaggebende Faktor für
eine Entscheidung zugunsten der vor-
geschalteten Enteisenung sein.
Für die gleiche Verfahrenskonstellati-
on, aber auch für eine ähnliche (ohne
Enthärtungsschritt) stellt sich die Fra-
ge, ob es sinnvoll wäre, die beiden
Reststoffe gleicher Konsistenz auch
zusammen nachzubehandeln, zu la-
gern und abzutransportieren. Für die
Investition würden sich bei gemeinsa-
mer Behandlung einige Synergien und
damit Einsparungen an Investitionen
ergeben.
Vermeidung von Chemikalien
zugaben
Aus der gewünschten Beschaffenheit
des Reststoffes kann sich über die Ver-
meidung von Chemikalienzugaben
Worauf ist bei der Planung
zu achten?
Bereits innerhalb der Vorplanung sind
die Aspekte der Reststoffverwertung so
weit zu durchdenken, dass die bauli-
chen und wirtschaftlichen Einflüsse in
sämtliche Betrachtungen einfließen. An
der einen oder anderen Stelle kann dies
sogar die Wahl des Verfahrens für die
Trinkwasseraufbereitung bestimmen.
Auf jeden Fall aber sind Rohrleitungen,
Armaturen, Aggregate und Bauteile da-
raufhin auszulegen. Wichtige Aspekte
betreffen auch die Hydraulik sowie die
Steuerung und Regelung der Prozesse.
Die Art des Abtransportes ist entschei-
dend für die Art der Lagerung. Meis-
tens werden Reststoffe durch LKW
oder Saugwagen abtransportiert. Da-
her muss der Ladeplatz gut für LKW
erreichbar sein. Hier müssen folgende
Aspekte bedacht werden:
•
Zufahrtsmöglichkeit für entspre-
chende Transportfahrzeuge,
•
gegebenenfalls Wende- oder Durch-
fahrtsmöglichkeiten,
•
Beschaffenheiten von Zufahrt und
Ladeplatz.
In Abhängigkeit von der Konsistenz
des Reststoffes müssen die Art und die
Lokalisierung des Speichers geplant
werden. Dabei treten folgende typi-
sche Fälle auf:
Nicht pumpfähige Feststoffe werden
beispielsweise
•
als rollige Materialien (Pellets) im Silo
gespeichert. Der LKW fährt darunter
und der Feststoff rieselt auf den LKW,
alternativ fährt LKW seitlich neben
den Silo und der Feststoff wird mit
einer Förderschnecke geladen,
•
als Schlämme in Becken gespeichert
und manuell, gegebenenfalls mithil-
fe von Hebezeugen, Radladern oder
Injektoren (wieder mit Wasserzuga-
be!), auf LKW verladen,
•
aus Pressen oder Zentrifugen direkt
in den LKW oder Container geleitet,
•
in Containern restentwässert und
dann abgefahren.
Pumpfähige Suspensionen werden z. B.
•
als Kohle- oder Sand-Wasser-Gemi-
sche aus Filterbehältern durch gravi-
tatives Ableiten, Absaugen bzw. ma-
nuelles Befüllen in Injektoren in Si-
lofahrzeuge verbracht,
•
als Schlämme aus Tanks oder Becken
mit einer Förderpumpe in Silofahr-
zeuge gedrückt oder gesaugt,
•
als Schlämme aus Tanks oder Becken
gravitativ in tiefer stehende Silofahr-
zeuge abgelassen,
•
als Konzentrate oder Eluate gegebenen-
falls direkt aus demAufbereitungspro-
zess mit dem Prozessdruck über Rohr-
leitungen inAbwassersysteme geleitet.
Hiermüssenu. a. dasDVGW-Merkblatt
W222 [8] und das DVGW-Arbeitsblatt
W 236 [5] berücksichtigt werden.
Die Häufigkeit des Abtransportes wird
vom Jahresvolumen des Reststoffes
wie auch vom Ladevolumen und der
Nutzlast des LKW bestimmt.
Die Größe der Speicher richtet sich nach
folgenden Kriterien, wobei gegebenen-
falls Redundanzen für Lagerung und
Nachbehandlung erforderlich sind:
•
den erforderlichen Nachbehand-
lungszeiten für eine Entwässerung,
•
sinnvollen Transportintervallen,
•
möglichen Ausfallzeiten von Trans-
porten und
•
Tagesmengen der Reststoffe.
Einflussnahme auf die Beschaffen
heit des Reststoffes
Zur Verbesserung des Transportes (TS-
Gehalt) und/oder der Verwertbarkeit
muss in der Planung eine Einflussnah-
me auf die Beschaffenheit des Reststof-
fes bedacht werden. Dies kann erfol-
gen durch:
•
die Trennung nach separat verwert-
baren Stoffen,
•
die Vermeidung von Chemikalien-
zugaben bzw.
•
die gezielte Auswahl von Chemika-
lienzugaben oder
•
die Auswahl von Verfahren und
•
die Entwässerung.