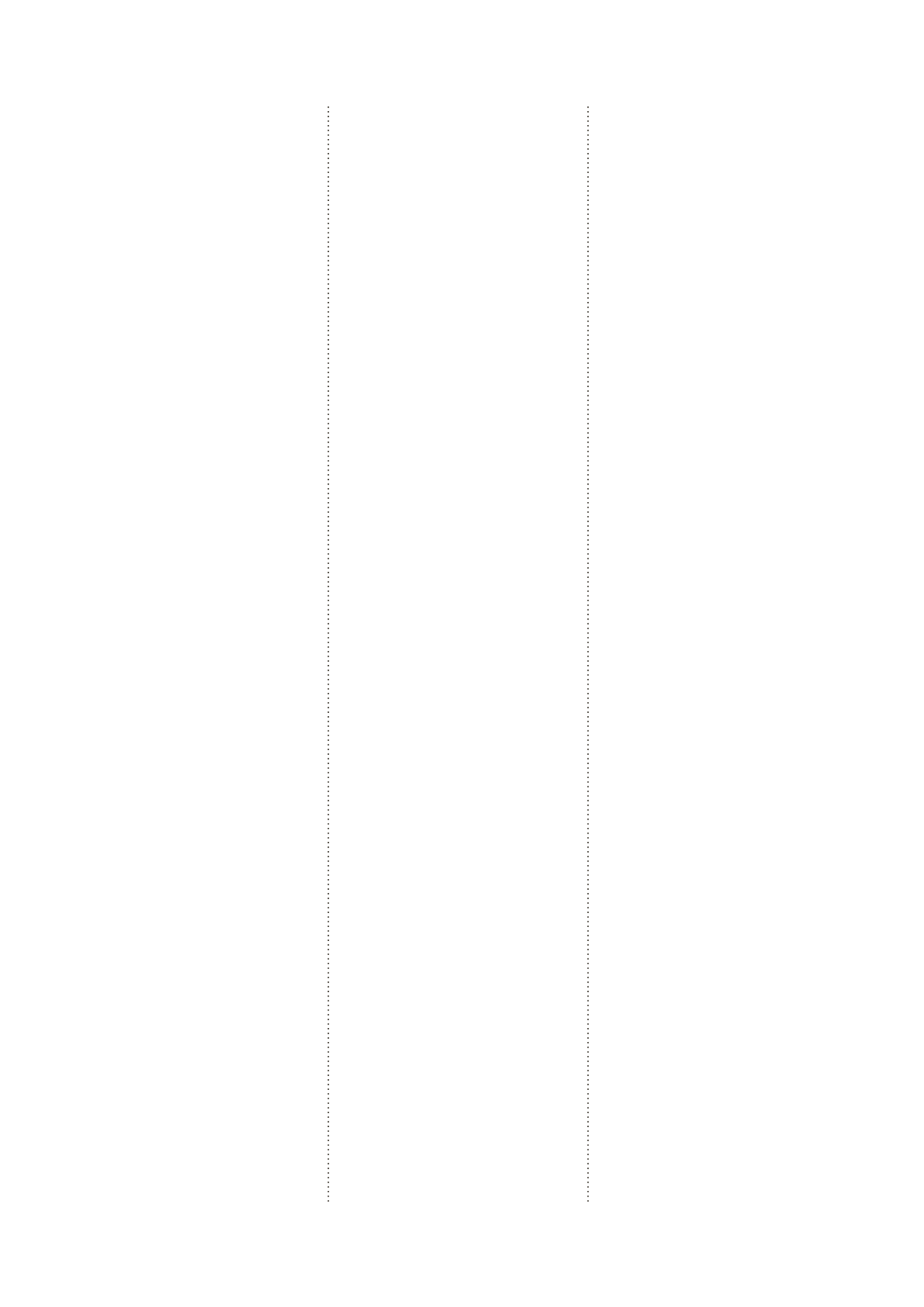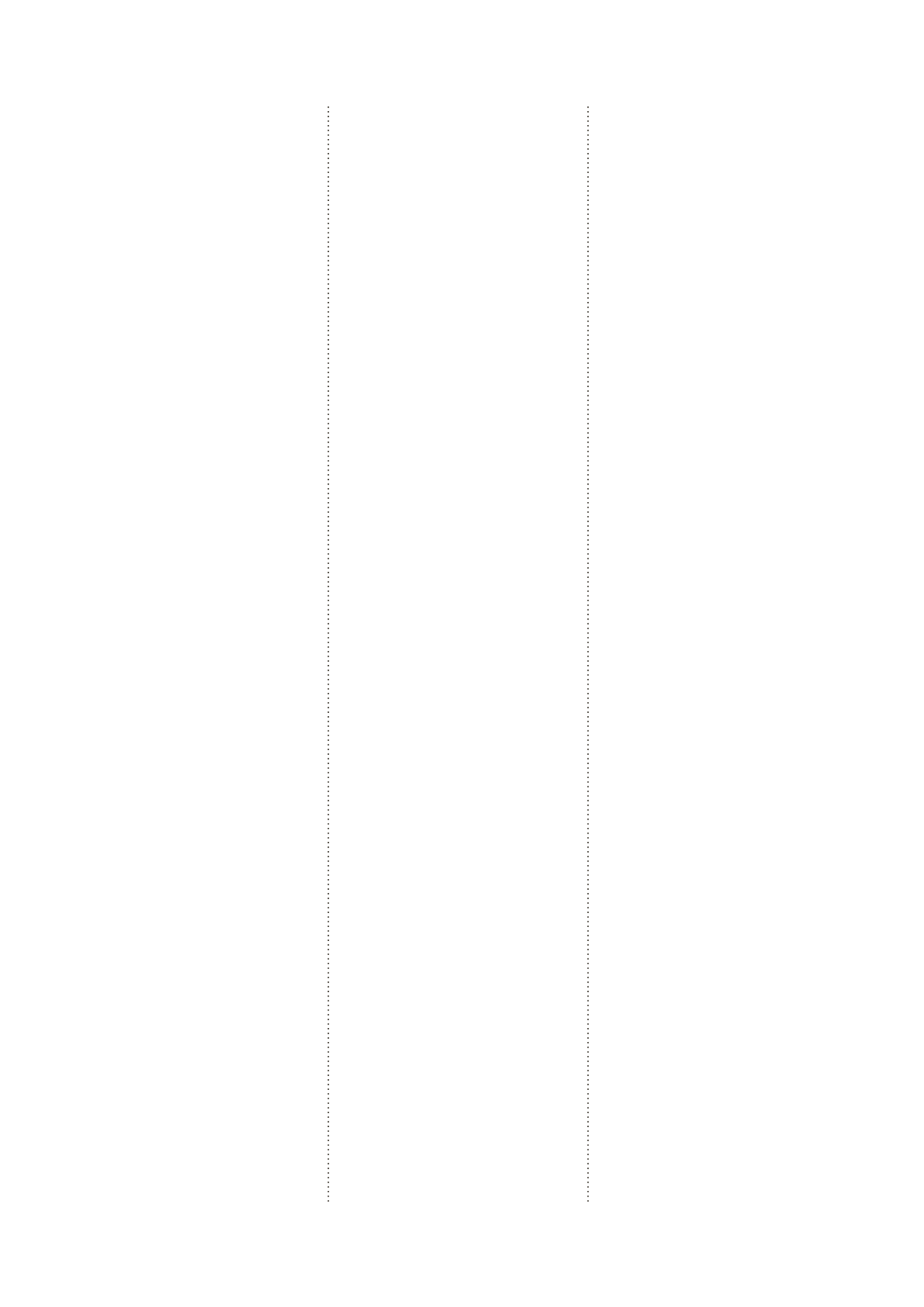
57
energie | wasser-praxis
10/2014
Grundsätzlich gilt dabei, dass die Ter-
mine und die Verantwortlichen für die
Umsetzung einer Maßnahme in Ab-
hängigkeit vom ermittelten Risikopo-
tenzial festzulegen sind. Kurz: Bei Ge-
fahr muss sofort reagiert werden. War
zum Beispiel der CO
2
-Gehalt bei einer
Messung zu hoch, darf der Schacht
nicht mehr betreten werden. Erst
wenn der Grenzwert durch geeignete
Maßnahmen wieder unterschritten
wird, ist der Schacht freigegeben.
Dokumentation
Was die Dokumentation der Gefähr-
dungsbeurteilung betrifft, gibt es kei-
ne Vorgaben. Aus den Unterlagen soll-
ten aber folgende Ergebnisse ersicht-
lich sein:
•
ermittelte Gefährdungen
•
festgelegte Arbeitsschutzmaßnah-
men
•
Wer ist verantwortlich?
•
Überprüfung der Realisierung und
Wirksamkeit der Maßnahmen
Das Wichtigste zum Schluss:
dranbleiben
Steht das Grundgerüst der Gefähr-
dungsbeurteilung, sollte mindestens
einmal im Jahr ein Treffen zur Aktua-
lisierung stattfinden. Dazwischen
empfiehlt es sich, einen kontinuierli-
chenWissenstransfer zu den Mitarbei-
tern zu pflegen – zum Beispiel durch
Sicherheitsgespräche mit den Sicher-
heitsbeauftragten oder sonstigen Mit-
arbeitern, Betriebsbesichtigungen
oder Interviews.
Eine weitere Möglichkeit, die Kompe-
tenzen der Mitarbeiter abzufragen und
so für einen regelmäßigen Wissens-
transfer zu sorgen, sind Interaktions-
trainings anstelle von Unterweisun-
gen. In Kleingruppen erforschen die
Mitarbeiter Gefahren und Belastun-
gen aus ihrer Arbeit und diskutieren
Lösungsansätze. Die Gefahren- und
Belastungspotenziale aus der täglichen
Praxis der Monteure fließen so in die
Gefährdungsbeurteilung ein. Die Ge-
fährdungsbeurteilung bleibt auf diese
in der Regel auch umgesetzt. Der An-
teil organisatorischer Unfallursachen
liegt zwischen 10 und 20 Prozent.
Zwar werden durch Managementsys-
teme wie Technisches Sicherheitsma-
nagement oder Qualitätsmanagement
Verantwortlichkeiten geregelt, doch
bedeutet das nicht zwangsläufig, dass
sie auch umgesetzt werden. Die Ver-
antwortung für Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz ist vermeintlich
delegiert. Dadurch werden bestehen-
de Organisationseinheiten aber nur
sehr bedingt reflektiert und korri-
giert, geschweige denn kontinuierlich
verbessert.
Das Einmaleins einer
Gefährdungsbeurteilung
Bevor der Startschuss für die Gefähr-
dungsbeurteilung fällt, sollten alle Be-
schäftigten über das geplante Vorge-
hen informiert werden. So wird eine
höhere Akzeptanz erreicht und die
Mitarbeiter sind motivierter mitzuar-
beiten und ihre Anliegen einzubrin-
gen. Immerhin geht es um ihre Ar-
beitsplätze.
Gefährdungsbeurteilungs-Team
Zu Beginn der Gefährdungsbeurtei-
lung bildet sich ein Team aus den zu-
ständigen Führungskräften, der Si-
cherheitsfachkraft und den Sicher-
heitsbeauftragten; eventuell kommen
der Betriebsrat und der Betriebsarzt
hinzu. Dieses Team klärt zunächst die
Mitwirkungsmöglichkeiten der Mitar-
beiter, Ziele der Gefährdungsbeurtei-
lung und die Vorgehensweise. Zur Vor-
bereitung werden oft Unfallstatisti-
ken, Begehungs- und Unterweisungs-
protokolle und branchenbezogene
Handlungshilfen (z. B. BG Etem, Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAuA)) eingesehen.
Schritt für Schritt: die Analyse
aller Arbeitsbereiche
Sind alle Vorbereitungen abgeschlos-
sen, nimmt das Team rund um die
Gefährdungsbeurteilung alle Bereiche
des Unternehmens unter die Lupe:
Wo lauern offensichtliche und ver-
deckte Gefahren? In Versorgungsun-
ternehmen werden klassischerweise
das Lager, der Straßenverkehr, Baustel-
len, der Kundenbereich, Schächte, der
Rufbereitschaftsdienst und die Ver-
waltung angeschaut. Um eine mög-
lichst umfassende Betrachtungstiefe
zu gewährleisten, werden alle Berei-
che noch weiter unterteilt: Im Lager
könnte das etwa bedeuten, die Be-
und Entladung, den Lagerbetrieb, das
Freilager, das Lagerbüro und die Zu-
trittsregelung zum Hallenlager jeweils
gesondert zu untersuchen. Schritt für
Schritt werden auf diese Weise alle
Arbeitsbereiche und Arbeitsplätze
bzw. Arbeitstätigkeiten im Unterneh-
men genau analysiert. Ein Beispiel:
der Arbeitsplatz eines Wassermon-
teurs am Schacht. Hier würde man im
Rahmen einer Gefährdungsbeurtei-
lung vor Ort und Stelle folgende Fra-
gen beleuchten: Gibt es Einstiegshil-
fen? Wird die Atmosphäre vor Eintritt
in den Schacht gemessen? Wird die
Begehung vorschriftsmäßig zu zweit
gemacht? Bleibt ein Mitarbeiter als
Sichtposten oben, während der an-
dere Monteur hinabsteigt? Sind die
Steigeisen in Ordnung? Ist der Schacht-
Zugang frei oder zugewuchert? Im
Anschluss werden die Ergebnisse mit
den Vorschriften abgeglichen. Das
Team prüft, ob die bereits bestehen-
den Arbeitsschutzmaßnahmen aus-
reichen.
Präventions- und Arbeitsschutz-
maßnahmen
Werden Mängel festgestellt, legt das
Team der Rangfolge nach technische,
organisatorische und personenbezo-
gene Präventions- und Arbeitsschutz-
maßnahmen fest. In puncto Schacht
kann das z. B. heißen:
1. technische Maßnahme: Installation
einer hochziehbaren Wasseruhr
oder Brunnenstube
2. organisatorische/technische Maß-
nahme: Einführung einer Zähler-
fernauslesung
3. personenbezogene Maßnahme:
Warnweste im Straßenverkehr