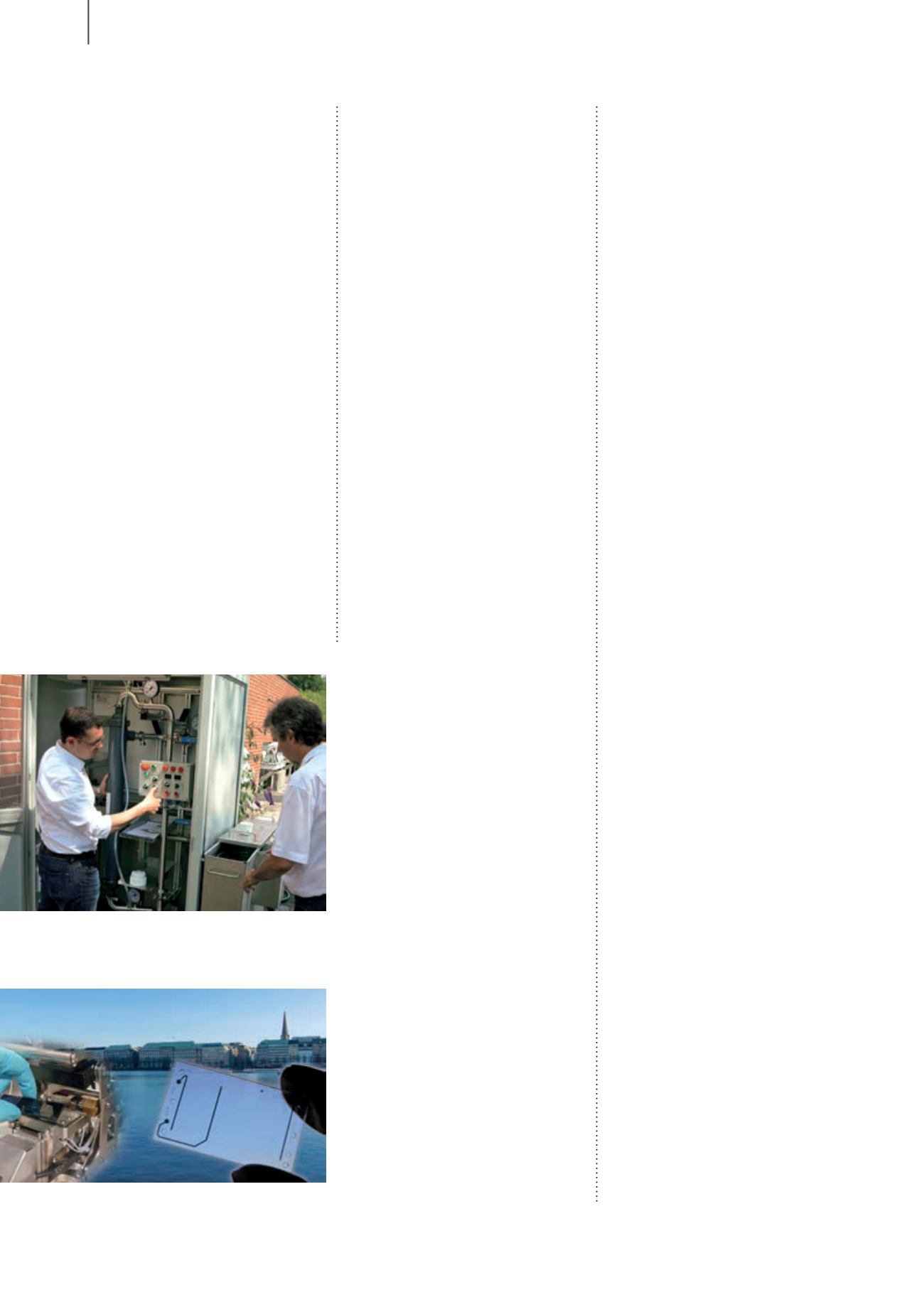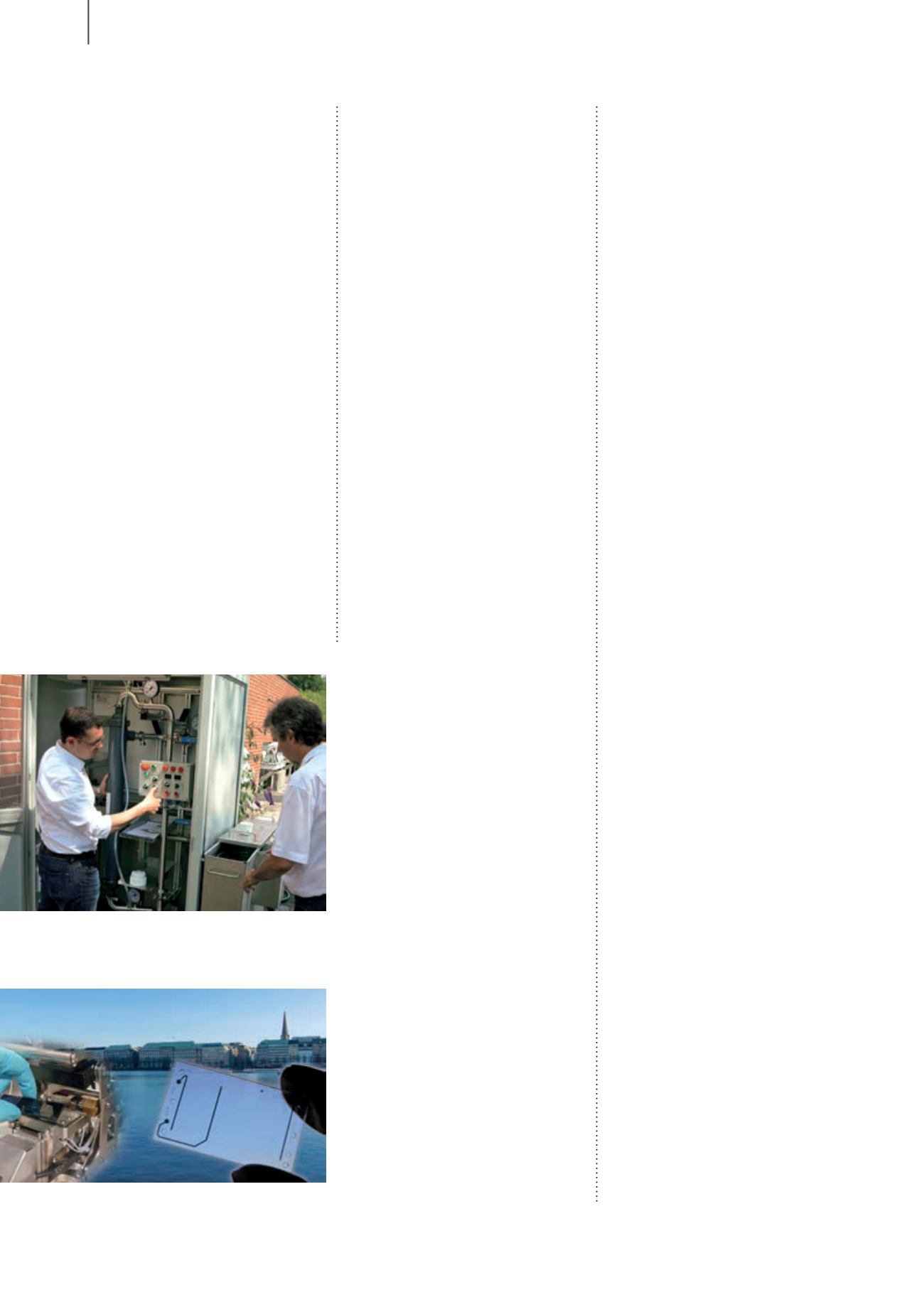
74
F O R S C H U N G & E N T W I C K L U N G
energie | wasser-praxis
10/2014
wasserbedarfs zur Brandbekämpfung
durch veränderte Löschtechniken und
die Einbindung dezentraler Alternati-
ven zur Löschwasserbereitstellung
(Löschwasserteiche, Zisternen, Lösch-
wassernetze). Darüber hinaus sollen
die bisherigen Bemessungsregeln zur
Löschwasserbereitstellung überprüft
und gegebenenfalls Änderungsvor-
schläge abgeleitet werden.
Ein weiterer Forschungsfokus liegt auf
der Konzeptionierung selbstreinigen-
der Trinkwassernetze. Durch eine hy-
draulisch sinnvolle Vermaschung von
Leitungen und gegebenenfalls ange-
passten Nennweitenänderungen sollen
Trinkwasserteilnetze durch die täglich
auftretenden Spitzenentnahmen regel-
mäßig gespült werden, um so der Be-
lagbildung und Sedimentation bei Sta-
gnationsphasen vorzubeugen. Schließ-
lich werden alle Maßnahmen hinsicht-
lich ihrer Umsetzbarkeit und Eignung
zur Integration in die bestehenden
Systeme untersucht. Die während des
Projekts entwickelten neuen Konzepte
und die Zusammenhänge in urbanen
Wasserinfrastrukturen werden Fach-
leuten und Laien mittels eines Pla-
nungsunterstützungssystems und eines
Simulationsspiels (Serious Game) zu-
gänglich gemacht
(Abb. 2)
.
Qualitätsüberwachung
im Leitungsnetz
Klimawandel und demografische Ver-
änderungen können, insbesondere in
ihremZusammenspiel, neben der Roh-
wasserverfügbarkeit auch die hygieni-
sche Beschaffenheit von Roh- und
Trinkwasser beeinflussen. Häufigere
Extremwetterlagenmit Starkregen und
Hochwasser oder ausgedehnte Tro-
ckenperioden können zeitweise zu ei-
ner Verschlechterung der Rohwasser-
qualität führen. Darüber hinaus erhö-
hen sich die Stagnationszeiten durch
die rückläufige Wasserentnahme aus
den Trinkwassernetzen. Hieraus erge-
ben sich potentielle Risiken für die
Trinkwasserhygiene.
Derzeitige Analyseverfahren sind zwar
zuverlässig, aber zeitintensiv. Erreger-
nachweise benötigen je nach Spezies
zum Teil mehrere Tage. Zeit, die bei
der Einleitung von möglichen Gegen-
maßnahmen zum Schutz der Bevölke-
rung benötigt wird. Zudem werden
Proben ohne spezielle Indikation nur
auf wenige vorgeschriebene, leicht
kultivierbare Indikatorbakterien un-
tersucht. Insbesondere schwer kulti-
vierbare, aber zum Teil hochinfektiöse
Viren werden routinemäßig nicht be-
rücksichtigt. Aus diesen Gründen be-
steht Bedarf an einem Detektionssys-
tem, das unterschiedlichste Krank-
heitserreger schnell und sicher nach-
weisen kann. Diese Aufgabe bildet den
Arbeitsschwerpunkt des INIS-Ver-
bundprojekts EDIT: Entwicklung und
Implementierung eines Anreiche-
rungs- und Detektionssystems für das
Inline-Monitoring von wasserbürtigen
Pathogenen in Trink- und Rohwasser.
Das Gesamtsystemwird eine mehrstu-
fige Ankonzentration zur Verringerung
des Probevolumens von etwa einembis
mehreren m
3
bis auf wenige µl erlau-
ben. ImBerlinerWasserwerk Friedrichs-
hagen wurde bereits eine zweistufige
Ultrafiltration als erste Teilkomponente
in Testbetrieb genommen
(Abb. 3 a)
.
Die erste Stufe erlaubt eine kontinuier-
liche Ankonzentrierung von bis zu
1,5 m³ Wasser pro Stunde. Das gewon-
nene 20 -l- Konzentrat kann in der zwei-
ten Stufe in 30 Minuten auf 100 ml
weiter reduziert werden. Die in der Aus-
gangsprobe enthaltenenMikroorganis-
menwerden dabei in hohemMaße wie-
dergefunden. Der Testbetrieb im Som-
mer 2014 soll zeigen, inwiefern die Sys-
teme für den Praxiseinsatz und die
Verarbeitung von Rohwasser geeignet
sind. Die weiteren Prozessschritte zur
Mikroankonzentration (auf ca. 20 µl)
und Probenpräparation werden in ei-
nem Lab-on-chip-System
(Abb. 3 b)
realisiert. Die Detektionseinheit des in
EDIT entwickelten Hygiene-Online-
Monitoring-Systems (HOLM) beruht
auf der Vervielfältigung der Organis-
mennukleinsäure mittels Multiplex-
Amplifikation und einem Chip-basier-
ten molekularbiologischen Erreger-
nachweis. Das Nachweissystem wird
zudem mit einem Modul zur Lebend/
Tot-Unterscheidung ergänzt.
Externe Schnittstellen sollen die Kom-
munikation des HOLM-Systems mit
dem Prozessleitsystem des Wasserver-
sorgers ermöglichen. So kann in Zu-
kunft schneller und gezielter auf eine
Kontamination des Leitungsnetzes
reagiert und der Infektion von Ver-
brauchern über gezielte Desinfektions-
maßnahmen vorgebeugt werden.
Praxiseinbindung und Umsetzung
in Modellgebieten
Kennzeichnend für alle Forschungs-
projekte der Fördermaßnahme INIS
sind die interdisziplinäre Vorgehens-
weise sowie das enge Zusammenwir-
ken von Wissenschaft und Praxis.
Etwa die Hälfte der insgesamt 80 in
INIS geförderten Institutionen sind
Kommunen, Unternehmen, Zweckver-
bände und sonstige Praxisakteure.
Weitere Praxispartner sind als assozi-
ierte Partner oder über Unteraufträge
eng in die Verbünde eingebunden. Der
Modellcharakter der Forschungspro-
Abb. 3 a:
Start des Testbetriebs der ersten Stufe
des Ankonzentrationssystems bei den Berliner
Wasserbetrieben im Juli 2014
Quelle: Daniel Karthe
Abb. 3 b:
Lab-on-chip-System für die Erreger-Extraktion
Quelle: Johannes Otto