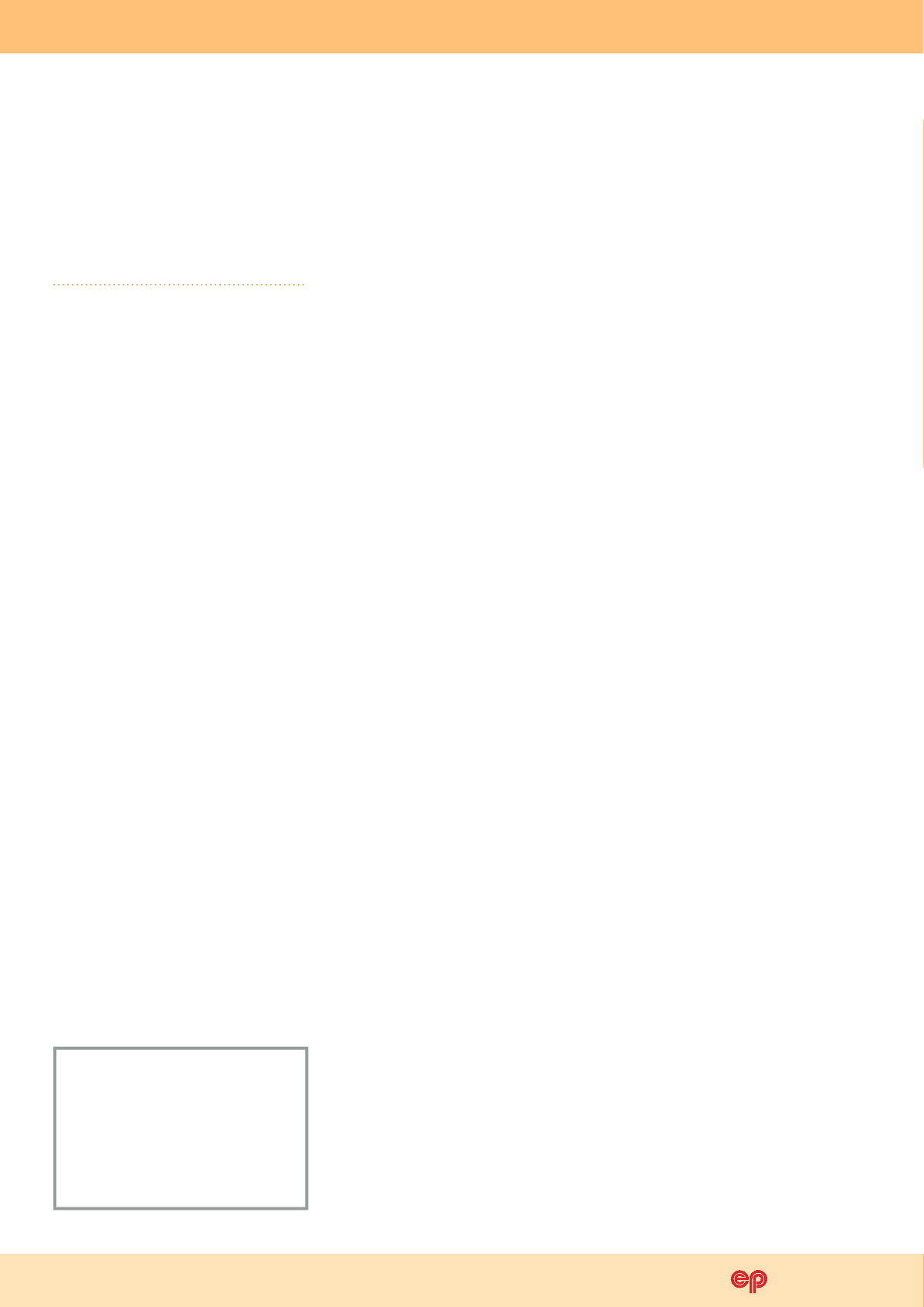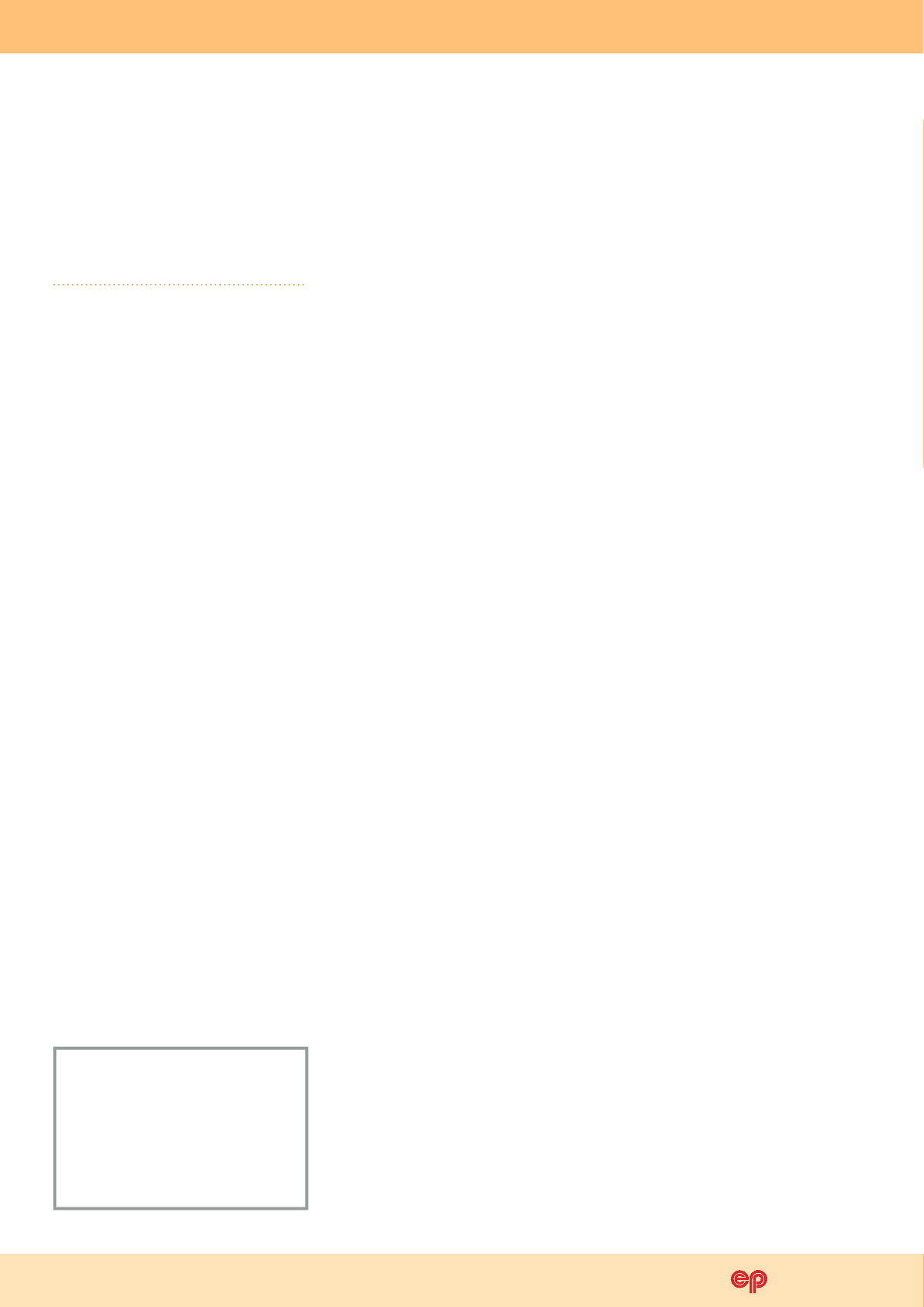
52
– Sonderheft
BLITZSCHUTZMAßNAHMEN
H.-D. Betz,
München
Das Europäische Komitee für elek-
trotechnische Normung CENELEC/
TC 81X hat sich ausführlich mit den
Fragen von Blitzvorkommen und
Blitzschutz befasst sowie Gewitter-
warnsysteme beschrieben. Die Er-
gebnisse sind in der Europäischen
Norm EN 50536 zusammengefasst;
hieraus werden im Folgenden eini-
ge wichtige Erkenntnisse darge-
stellt. Ferner wird ein neues Gewit-
terwarnsystem gezeigt, welches
Kurzfristvorhersagen von Gewit-
tern im Bereich bis zu etwa einer
Stunde erlaubt. Damit wird die
Möglichkeit geboten, rechtzeitig
Maßnahmen zu treffen, welche
eine Reihe von Blitzgefahren ver-
mindern oder vermeiden können.
1 Es gibt viele Gründe
für einen effektiven
Blitzschutz
Gewitter führen zu natürlichen atmo-
sphärischen Entladungen, bei welchen
insbesondere die Bodenblitze eine erheb-
liche Gefahr darstellen. In Deutschland
zählt man je km
2
und Jahr durchschnitt-
lich sechs Blitze, wobei durchaus regio-
nale Unterschiede auftreten. Immer wie-
der muss von Todesfällen aufgrund von
Blitzschlag berichtet werden; allein in
Deutschland sind dies etwa 30 Fälle pro
Jahr, die Zahl der Verletzten beläuft sich
auf ungefähr das Dreifache. Unmittelbare
Sachschäden einschließlich Brand ent-
stehen durch Direkteinschlag in Gebäude
und Strukturen, aber auch von einem
Gebäude räumlich entferntere Blitze kön-
nen zu Überspannungsschäden führen.
Die Anzahl der gemeldeten Blitzschäden
dürfte in Deutschland bei ungefähr einer
halben Million liegen. Aus diesem Grund
ist es notwendig, effektiven Blitzschutz
zu betreiben.
2 Blitzvorkommen
und Blitzschutz
Das Europäische Komitee für elektrotech-
nische Normung CENELEC/TC 81X hat
sich ausführlich mit den Fragen von Blitz-
vorkommen und Blitzschutz befasst so-
wie Gewitterwarnsysteme beschrieben.
Die Ergebnisse sind in der Europäischen
Norm EN 50536 zusammengefasst. Ziel
der Norm EN 50536 ist, Informationen
betreffs der Eigenschaften von Systemen
zur Gewitterortung und Auswertung von
Echtzeit-Blitzdaten und/oder Gewitter-
elektrizitätsdaten zu liefern, um vorbeu-
gende Maßnahmen gegen Blitzgefahren
zu ermöglichen. Sie umfasst eine sum-
marische Beschreibung aller wesentlichen
Aspekte, welche mit Gewittern zusam-
menhängen. Dies reicht von der Gewit-
terbildung über die Klassifizierung von
Blitzortungssystemen bis zu Alarmaus-
lösung und Risikodiskussion.
Die übersichtlichen und weitreichenden
Darstellungen in der Norm sind sowohl
eine hervorragende Informationsquelle
als auch ein nützlicher Ratgeber für das
Elektro-Handwerk, die Gebäudetechnik
sowie den Blitz- und Arbeitsschutz. Dar-
über hinaus wird auch ersichtlich, welche
Risiken für die Allgemeinheit beim Auf-
enthalt im Freien bestehen und wie man
Gewitter- und Blitzgefahren begegnen
kann. Die Norm könnte auf zahlreiche
weitere Aktivitäten im Freien und techni-
sche Einrichtungen angewendet werden,
beispielsweise hinsichtlich Servicearbeiten,
Veranstaltungen, Landwirtschaft, Wind-
und Solaranlagen, Stromversorgungs-
leitungen, elektrische und elektronische
Systeme, Telekommunikation, Betrieb
von Infrastrukturen wie Flughäfen und
Schienenverkehr. Diese Aufzählung ließe
sich noch erheblich verlängern, zeigt
aber die Zielrichtung der Norm.
3 Gewitterentwicklung
Gewitterentwicklung beinhaltet eine stati-
sche Aufladung der Wolken. Dadurch ent-
stehen auch am Boden messbare elektro-
statische Felder, welche zu Entladungen
führen und daher ein Gefahrenpotential
darstellen können, bevor es zur eigentli-
chen Blitztätigkeit kommt. Aus diesem
Grunde werden auf vielen Einrichtungen
elektrostatische Feldsonden betrieben,
z.B. auf Flughäfen oder Minen für den
Tageabbau. Wenn sich ein ausreichendes
Potential in der Größenordnung von etwa
40 MV zwischen Wolke und Boden gebil-
det hat, setzen Blitzentladungen ein. Für
eine einzelne Blitzzelle definiert man An-
fangs-, Wachstums-, Reife-, und Zerfalls-
stadium. Die gesamte Lebensdauer einer
Zelle beträgt typischerweise ½ bis 1½
Stunden; allerdings findet bei nicht zu
schwachen Gewittern ein ständiger Neu-
bildungsprozess statt, sodass Gewitterver-
bände deutlich länger aktiv sein können.
So zog beispielsweise die Sturm- und Ge-
witterfront EMMA am1. März 2008 über
acht Stunden lang mit Geschwindigkeiten
von bis zu 130 km/h über Europa hinweg.
4 Blitzmessung
Blitze lassen sich mit den verschiedensten
Methoden messen. Früher hatte man
sich auf visuelle Beobachtungen be-
schränkt, aber zuverlässige und umfas-
sende Registrierung erfordert vollauto-
matische Systeme. Die ersten Anlagen
waren Einzelsensoren, zunächst akus-
tisch, dann gefolgt von Techniken im
elektromagnetischen Bereich. Hier sind
vor allem Frequenzen von 3–30 kHz
(VLF, Very Low Frequency), 30–300 kHz
(LF, Low Frequency) und 30–300 MHz
(VHF, Very High Frequency) geeignet. Die
Reichweiten sind sehr unterschiedlich:
]
Starke Blitzsignale können im VLF-Be-
reich die ganze Erde umrunden,
]
LF-Signale sind in der Regel bis knapp
1000 km erfassbar,
]
VHF-Impulse breiten sich nur entlang
der Sichtlinie aus und sind daher weni-
ger weit messbar.
Gewitter, Blitzschutz und
Gewitterwarnsysteme
Autor
Prof. Dr.
Hans-Dieter Betz
forscht auf dem
Gebiet der Elektrizität der Atmosphäre
mit Schwerpunkt Gewitterforschung und
leitet als Mitbegründer der Nowcast
GmbH, München, die Entwicklung von
Blitzmessnetzen und deren praktische
Anwendung.