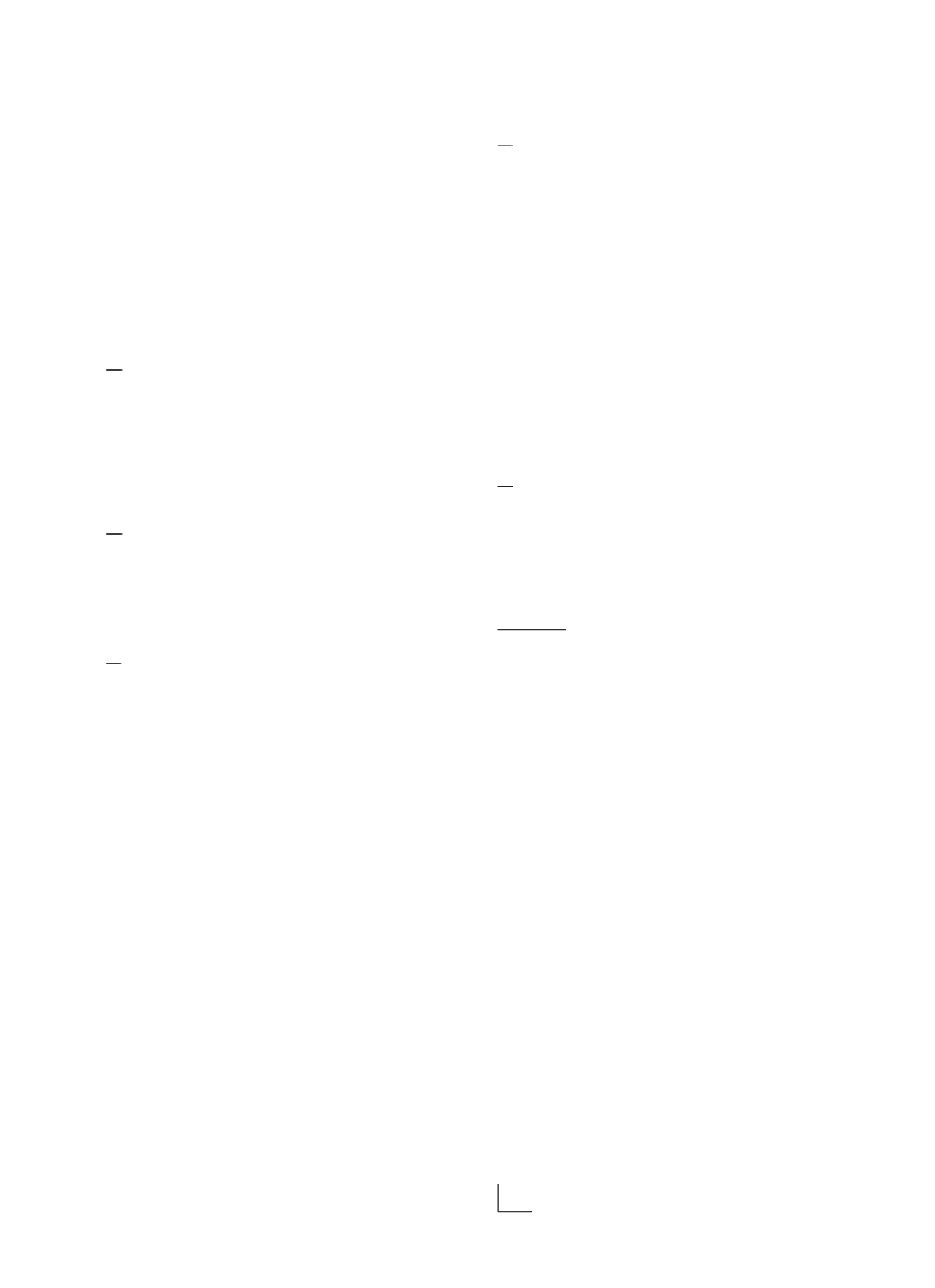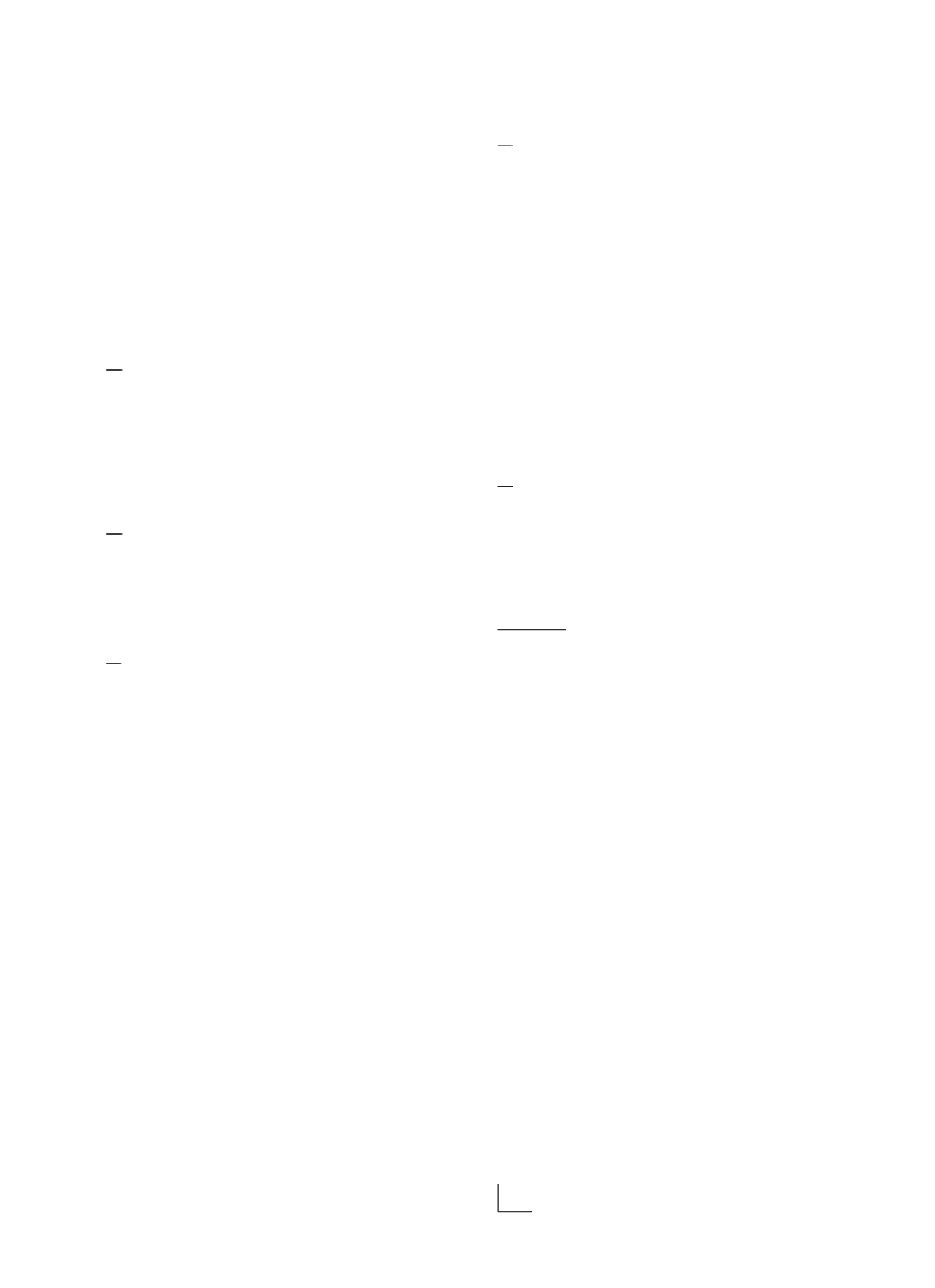
Mittelverwendungskontrolle. Diese Wu¨rdigung scho¨pft den
Vortrag der Kla¨gerin nicht aus. Sie hat geltend gemacht, diese
laxe Handhabung sei von Anbeginn pra¨gend fu¨r die Ausfu¨hrung
der Mittelverwendungskontrolle beider Fonds gewesen. Sollte
sich dies besta¨tigen, la¨ge ein vom Beklagten zu 2 zu offenbaren-
der Umstand vor, da die Emissionsprospekte einen anderen,
gu¨nstigeren Eindruck von der Intensita¨t der Mittelverwen-
dungskontrolle durch die Beklagte zu 1 erweckten. Das Beru-
fungsgericht wird daher Feststellungen zu den Behauptungen
der Kla¨gerin nachzuholen und die angebotenen Beweise zu erhe-
ben haben.
Zur Kenntnis des Initiators von dem Umfang der auf die Ermes-
sensklausel gestu¨tzten Mittelfreigaben
49
I
bb)
Soweit das Berufungsgericht gemeint hat, es sei nicht er-
sichtlich, dass der Beklagte zu 2 Kenntnis von dem Umfang der
auf die Ermessensklausel gestu¨tzten Mittelfreigaben gehabt ha-
be, hat es unberu¨cksichtigt gelassen, dass die Mittelanforderun-
gen von ihm ausgingen und er damit wusste, ob die formalen
Voraussetzungen fu¨r die Freigaben erfu¨llt waren oder ob die Er-
messensklauseln Anwendung finden mussten.
Zuru¨ckverweisung an das OLG und Hinweise des Senats
50
I
3.
Da aus den vorstehenden Gru¨nden die vom Berufungs-
gericht getroffenen Feststellungen unvollsta¨ndig und gegebenen-
falls Feststellungen zu den weiteren Voraussetzungen eines
Schadensersatzanspruchs gegen die Beklagten zu treffen sind, ist
die Sache noch nicht zur Endentscheidung reif. Sie ist deshalb
gem. § 563 Abs. 1 und 3 ZPO an das Berufungsgericht zuru¨ck-
zuverweisen.
51
I
Fu¨r das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:
Zur missbra¨uchlichen Handhabung der Ermessensklauseln
52
I
a)
Das Berufungsgericht hat bei der Frage, ob die Vorgaben
des Mittelverwendungskontrollvertrags durch die u¨berma¨ßige
Anwendung der Ermessensklauseln systematisch unterlaufen
wurden und deshalb eine (vorvertragliche) Aufkla¨rungspflicht
verletzt wurde, in den Blick genommen, in welchem Umfang
tatsa¨chlich von den Ermessensklauseln Gebrauch gemacht wur-
de. Diesem Umstand vermag auch bei der Pru¨fung indizielle Be-
deutung zukommen, ob den Beklagten ein vorsa¨tzliches delikti-
sches Fehlverhalten (Beklagte zu 1 §§ 264a, 27 StGB, § 826
BGB i. V. mit §§ 31, 831 BGB; Beklagter zu 2 § 264a StGB,
§ 826 BGB) vorgeworfen und nachgewiesen werden kann
22
. Das
Berufungsgericht hat bei seiner Vergleichsbetrachtung unter –
bedenklicher (s. nachfolgend c) – Zusammenfassung beider
Fonds die bis zu den Beitritten der Kla¨gerin erfolgten – unter-
stellt beanstandungswu¨rdigen – Freigaben in das Verha¨ltnis zu
den Gesamtausgaben der Fonds gesetzt und ist so zu einem An-
teil von 15% gelangt. Dieser geringe Anteil wa¨re aber nur dann
korrekt ermittelt und daher auch nur dann bezu¨glich einer miss-
bra¨uchlichen Handhabung der Ermessensklauseln aussagekra¨f-
tig, wenn feststu¨nde, dass bei den nach den Beitritten erfolgten
Freigaben auf diese Klauseln nicht (mehr) zuru¨ckgegriffen wurde
beziehungsweise werden musste. In die Betrachtung einzubezie-
hen ist demgegenu¨ber in erster Linie, in welchem Verha¨ltnis die
„Ermessensfreigaben“ zu den sonstigen Mittelfreigaben bis zu
den Zeitpunkten der Beitritte der Kla¨gerin standen. Soweit es
darum geht, ob aus dem (spa¨teren) Verhalten der Beklagten
Ru¨ckschlu¨sse auf vorgefasste Motive und Absichten gezogen
werden ko¨nnen, wa¨ren die gesamten Ermessensfreigaben zu den
Gesamtausgaben in Beziehung zu setzen.
Zur Annahme des erforderlichen (doppelten) Gehilfenvorsatzes
53
I
b)
In Bezug auf die Beklagte zu 1 ist zu beachten, dass bei
der Annahme des erforderlichen (doppelten) Gehilfenvorsatzes
in tatsa¨chlicher Hinsicht einerseits Vorsicht geboten ist. Ande-
rerseits wa¨re dann, wenn bei der Mittelfreigabe die formalen Vo-
raussetzungen fortlaufend und systematisch durch die Inan-
spruchnahme der Ermessensklauseln u¨berspielt worden wa¨ren,
eine Vorsatztat auch dann nicht ausgeschlossen, wenn die Frei-
gaben seitens der Beklagten zu 1 widerstrebend geschehen wa¨ren
und ihre Mitarbeiter bei dem einen oder anderen Freigabeer-
suchen des Beklagten zu 2 erfolgreich auf der Einhaltung der im
Mittelverwendungskontrollvertrag enthaltenen Vorgaben be-
standen ha¨tten. Ein „kollusives“ Zusammenwirken zwischen den
Beklagten dahingehend, dass zwischen diesen eine systematisch
vertragswidrige Handhabung der Mittelverwendungskontrolle
verabredet wurde, ist – entgegen der Auffassung des Berufungs-
gerichts – nicht erforderlich.
Zur unterschiedlichen Ausgestaltung der Voraussetzungen fu¨r
die Freigaben der ersten Raten in beiden Fonds
54
I
c)
Weiter ist zu beachten, dass die Voraussetzungen fu¨r die
Freigaben der ersten Raten in den Fonds MBP I und II im De-
tail unterschiedlich ausgestaltet sind. Das Berufungsgericht wird
daher bei der Wu¨rdigung des Vorbringens der Parteien diese
Differenzierungen zu beru¨cksichtigen und dementsprechend die
notwendigen Feststellungen zu treffen haben. Es wird dabei zu
beachten sein, dass die Beklagtenseite insoweit die sekunda¨re
Darlegungslast treffen kann
23
.
22 Siehe dazu BGH-Urteil vom 20. 12. 2011 – VI ZR 309/10, DB0468589 = NJW
2012 S. 404, Rdn. 9 ff.
23 Siehe hierzu Senatsurteil vom 15. 3. 2012 – III ZR 190/11, DB0474654 =
NJW 2012 S. 2103, Rdn. 21 und vom 17. 1. 2008 – III ZR 239/06,
DB0282233 = NJW 2008 S. 982, Rdn. 16, m. w. N.
Allgemeine Gescha¨ftsbedingungen
Zur fu¨r Unterlassungsanspruch erforderlichen
Wiederholungsgefahr im Falle der Rechtsnach-
folge durch Verschmelzung
UKlaG § 1
a)
Enthalten die von einem Unternehmen (hier: Mobilfunk-
anbieter) abgeschlossenen Vertra¨ge nach Maßgabe der §§ 307
ff. BGB unwirksame Klauseln, so begru¨ndet dies, wenn der
Rechtstra¨ger des Unternehmens nach Maßgabe des Umwand-
lungsgesetzes auf einen anderen Rechtstra¨ger verschmolzen
wird, auch im Falle der Fortfu¨hrung des Betriebs bei dem u¨ber-
nehmenden Rechtstra¨ger keine – fu¨r einen Unterlassungs-
anspruch aus § 1 UKlaG erforderliche – Wiederholungsgefahr
(im Anschluss an BGH, Urteil vom 26. 4. 2007 – I ZR 34/05,
BGHZ 172 S. 165).
b)
Da der neue Rechtstra¨ger in die abgeschlossenen Vertra¨ge
eintritt, sind in einem solchen Falle an die Begru¨ndung einer
Erstbegehungsgefahr (hinsichtlich des Sich-Berufens) keine all-
zu strengen Anforderungen zu stellen.
BGH-Urteil vom 6. 12. 2012 – III ZR 173/12
u
DB0573676
Redaktioneller Hinweis:
Volltext unter DB0572825.
DER BETRIEB | Nr. 25 | 21. 6. 2013
Wirtschaftsrecht
1415