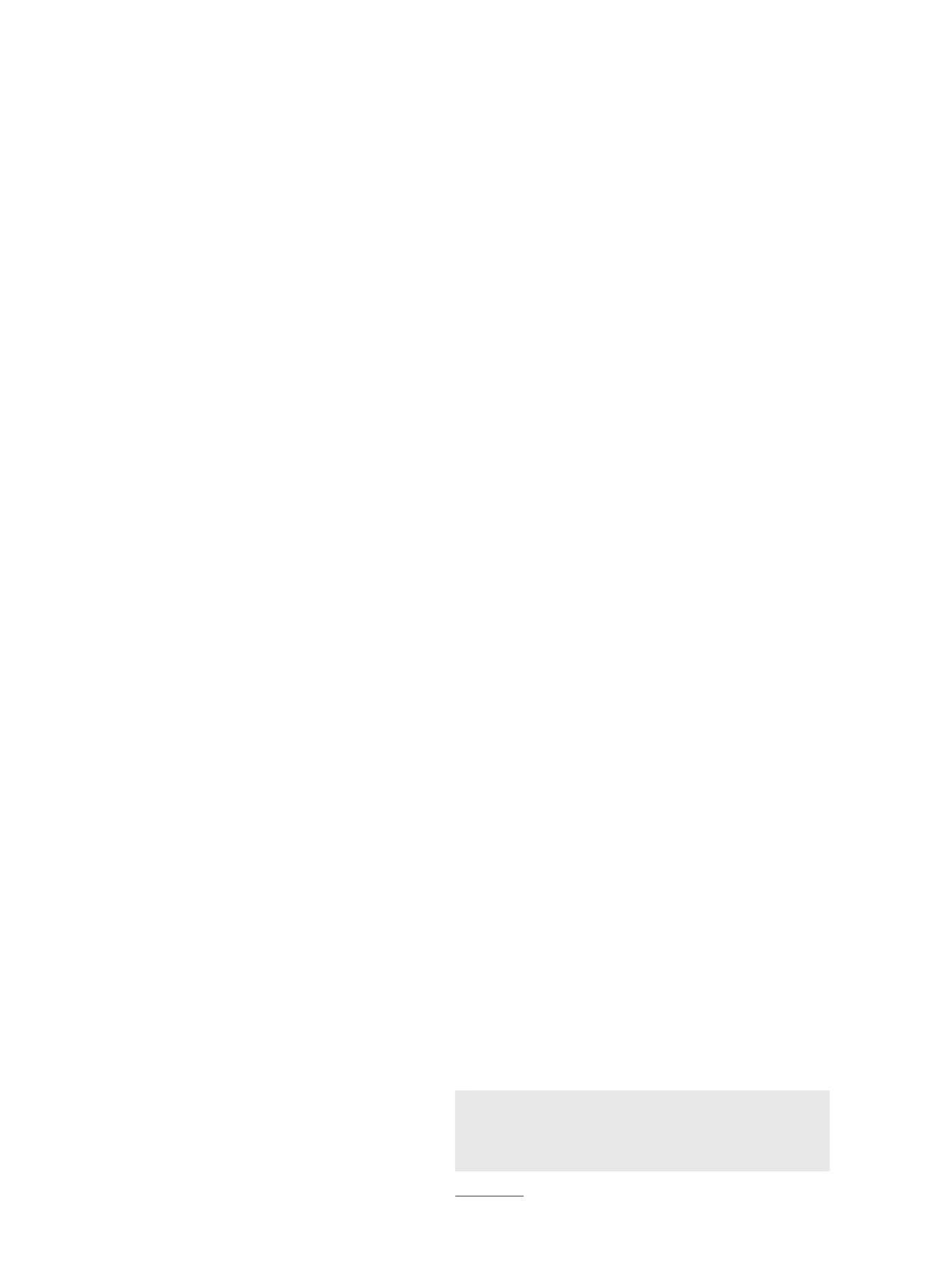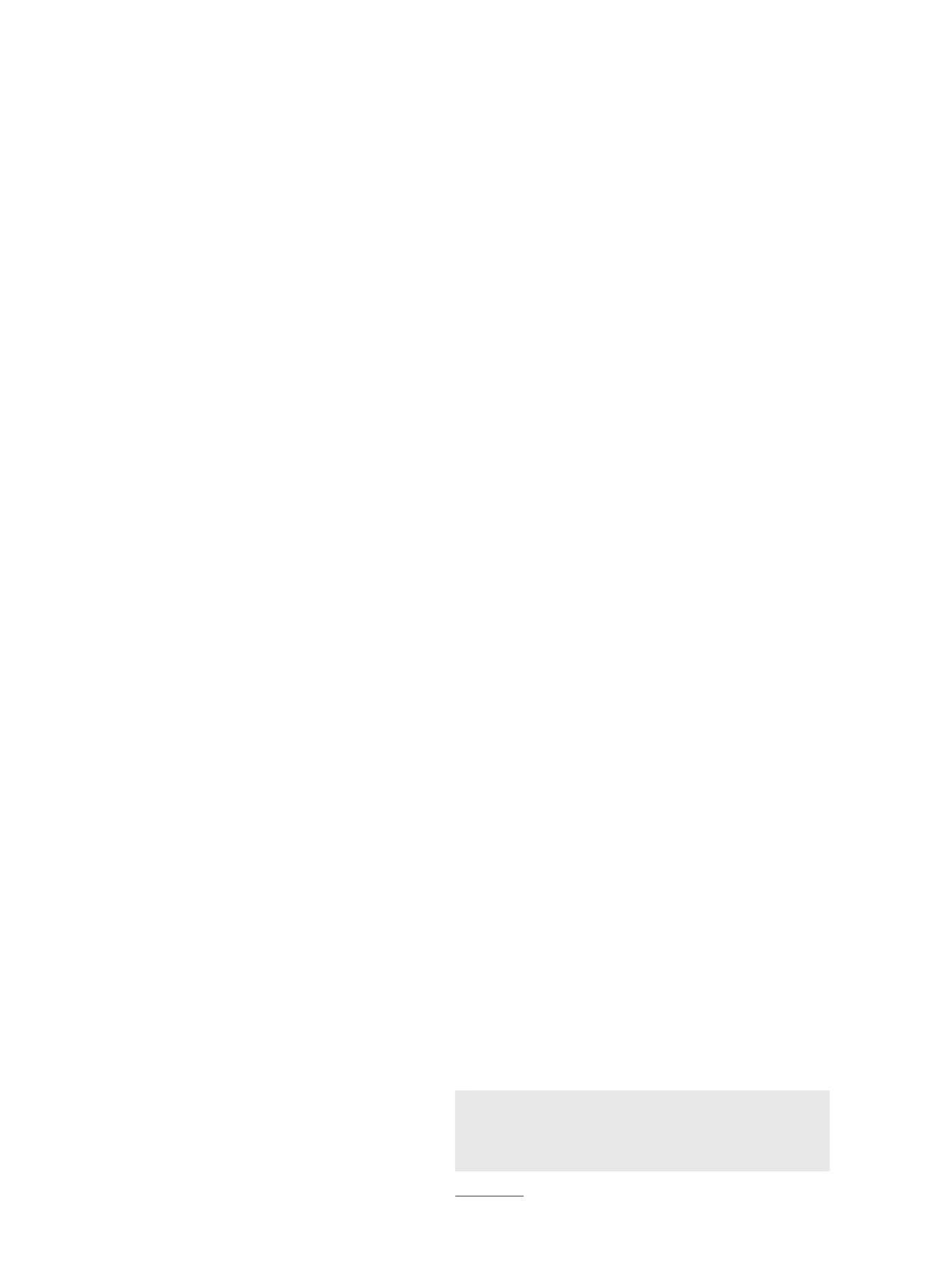
RA Dr. Roman Frik, LL.M. (Ko¨ln/Paris), FAArbR / RA Dr. Ralf Klu¨he, Stuttgart
Nutzung von Kontakten aus sozialen Netzwerken
wa¨hrend und bei Beendigung des Arbeitsverha¨lt-
nisses
u
DB0592454
I. Einleitung
Soziale Netzwerke, die den Aufbau und die Pflege beruflicher
Kontakte ermo¨glichen, werden immer beliebter – und wichtiger.
Die Bewerbung von Produkten, Dienstleistungen und Ver-
anstaltungen findet zunehmend auch u¨ber diese sozialen Netz-
werke statt. Einfacher Grund hierfu¨r ist die sta¨ndig steigende
Zahl an Mitgliedern und Nutzern. Die deutsche Netzwerkplatt-
form XING z. B. hat derzeit u¨ber 12 Mio. Mitglieder, davon
5,7 Mio. im deutschsprachigen Raum. Die Vorteile liegen klar
auf der Hand. Kontakte sind schnell geknu¨pft. Mit der Besta¨ti-
gung des Kontakts erha¨lt der Nutzer eine Adresse, die fu¨r die
perso¨nliche Ansprache, aber auch fu¨r großfla¨chige Werbeaktio-
nen genutzt wird. International ist LinkedIn der fu¨hrende An-
bieter und bietet a¨hnliche Dienste wie XING.
So scho¨n und effektiv die Nutzung auch sein mag, arbeits-
rechtlich stellen sich eine ganze Reihe von Fragen. Du¨rfen die
Netzwerke wa¨hrend der Arbeitszeit und u¨ber den dienstlichen
Internetanschluss genutzt werden? Darf der Arbeitgeber vom
Arbeitnehmer verlangen, einen Account mit Hinweis auf das
Unternehmen einzurichten? Darf er bei der Ausgestaltung des
Netzwerkauftritts mitsprechen? Wann darf der Betriebsrat bei
der Einrichtung und dem Betrieb solcher Accounts mitbestim-
men?
Hier soll das Augenmerk nur auf zwei besonders wesentliche
Fragen gerichtet werden:
– Darf der Arbeitnehmer u¨ber seinen privaten Netzwerk-
Account Kontakte zu Gescha¨ftspartnern des Arbeitgebers
aufnehmen und diese als Kontakte/Freunde gewinnen?
– Muss der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsverha¨lt-
nisses dem Arbeitgeber die wa¨hrend des Arbeitsverha¨ltnisses
gewonnenen Kontakte „zuru¨ckgeben“ und deren Daten an-
schließend lo¨schen?
II. Kontakte im sozialen Netzwerk wa¨hrend des Ar-
beitsverha¨ltnisses
Meist wird ein Arbeitgeber kein Problem damit haben, wenn
sein Mitarbeiter u¨ber ein soziales Netzwerk Kontakt zu Ge-
scha¨ftspartnern ha¨lt. Das festigt das Kontaktnetz des Mitarbei-
ters und kann dem Arbeitgeber nur zu Gute kommen. Es mag
aber auch Arbeitgeber geben, die u¨ber diese Kontaktaufnahme
nicht erfreut sind. Sei es, dass der Arbeitgeber eine Vertriebsstra-
tegie hat, zu der soziale Netzwerke nicht geho¨ren. Sei es, dass
der Arbeitgeber soziale Netzwerke nur dann einsetzen will, wenn
die dortigen Auftritte mit ihm abgesprochen sind, ein Mitarbei-
ter hierzu nicht bereit ist und der Arbeitgeber ihm dann die wei-
tere Kontaktpflege u¨ber das soziale Netzwerk untersagen will.
Sei es schließlich, dass der Arbeitgeber befu¨rchtet, dass ein
Wettbewerber auf diese Weise Kenntnis von seinen Kunden be-
kommt, die er anschließend versucht abzuwerben. Kann er dem
Arbeitnehmer dann untersagen, Gescha¨ftspartner u¨ber soziale
Netzwerke zu kontaktieren und sie als „Kontakte“ oder „Freun-
de“ zu gewinnen?
1. Reglementierung durch vertragliche Regelung oder Direk-
tionsrecht
Sinnvollerweise regelt der Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer
ausdru¨cklich, wie er mit sozialen Netzwerk-Kontakten umzuge-
hen hat. Er ko¨nnte vertraglich vorsehen, dass der Arbeitnehmer
Gescha¨ftspartner des Arbeitgebers nicht u¨ber das soziale Netz-
werk kontaktieren bzw. dass er diese nicht als Kontakte/Freunde
gewinnen darf. Zula¨ssig wird dies allerdings nur soweit sein, als
ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers besteht und nicht das
allgemeine Perso¨nlichkeitsrecht nach Art. 2 Abs. 1 i. V. mit
Art. 1 Abs. 1 GG des Arbeitnehmers verletzt ist. Teil des Per-
so¨nlichkeitsrechts ist es, selbst zu entscheiden, ob und mit wem
eine Beziehung aufgebaut wird, sei es eine freundschaftliche, sei
es sogar eine Liebesbeziehung
1
. Ein berechtigtes Interesse des
Arbeitgebers wird sein, wenn er mit bestimmten Unternehmen
und/oder Personen keine Gescha¨ftsbeziehung unterhalten will
oder wenn er entscheidet, mit einem bestimmten Unternehmen
bzw. einer Person nicht auf dem Weg des sozialen Netzwerks ei-
ne Gescha¨ftsbeziehung zu unterhalten. So ko¨nnte eine traditio-
nelle Privatbank ihren Kundenberatern – auch einseitig im Wege
des Direktionsrechts – untersagen, die Kunden u¨ber das neumo-
dische und mitunter unperso¨nliche soziale Netzwerk anzuspre-
chen und stattdessen die telefonische oder perso¨nliche Anspra-
che anweisen. Die Grenze wird aber dort u¨berschritten und das
Perso¨nlichkeitsrecht dort tangiert sein, wo ein Arbeitnehmer
u¨ber den gescha¨ftlichen Kontakt hinaus eine private Beziehung
zu einem Gescha¨ftspartner aufgebaut hat oder auch nur aufbau-
en will. Im Einzelfall wird es fu¨r den Arbeitnehmer schwierig
sein nachzuweisen, dass der Kontakt die gescha¨ftliche Beziehung
u¨berschritten hat. Muss dazu bereits gemeinsam ein Bier getrun-
ken worden sein? Muss es ein Zusammentreffen in der Freizeit
gegeben haben?
2. Gesetzliche Grenzen
Außerhalb der vertraglichen Regelung wird man gerade auf-
grund des allgemeinen Perso¨nlichkeitsrechts nach Art. 2 Abs. 1
i. V. mit Art. 1 Abs. 1 GG nur dort ein Kontaktverbot im so-
zialen Netzwerk annehmen ko¨nnen, wo es eine ausdru¨ckliche
gesetzliche Verbotsnorm oder eine gesetzliche Verschwiegen-
heitspflicht gibt. In Betracht kommt hier § 17 UWG (Verrat
von Gescha¨fts- und Betriebsgeheimnissen). Ein Gescha¨fts-
Dr. Roman Frik
und
Dr. Ralf Klu¨he
sind Partner bei Vogel & Partner
Rechtsanwa¨lte, Stuttgart. Dr. Klu¨he ist Mitglied des Pru¨fungsaus-
schusses „Fachanwalt fu¨r Informationstechnologierecht“ der RAK
Stuttgart
1 LAG Du¨sseldorf vom 14. 11. 2005 – 10 TaBV 46/05, DB 2006 S. 162.
1174
Arbeitsrecht
DER BETRIEB | Nr. 21 | 24. 5. 2013